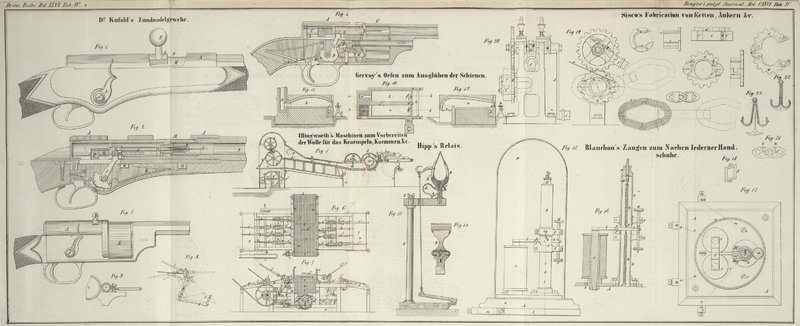| Titel: | Maschinen zum Vorbereiten der Wolle fürs Krempeln, Kämmen u.s.w., welche sich Daniel Illingworth, Wollenspinner zu Bradford in Yorkshire, am 22. Aug. 1850 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 126, Jahrgang 1852, Nr. XXXIII., S. 185 |
| Download: | XML |
XXXIII.
Maschinen zum Vorbereiten der Wolle fürs
Krempeln, Kämmen u.s.w., welche sich Daniel Illingworth, Wollenspinner zu Bradford
in Yorkshire, am 22. Aug. 1850 patentiren
ließ.
Aus dem London Journal of arts, Mai 1852, S.
338.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Illingworth's Maschinen zum Vorbereiten der Wolle fürs Krempeln,
Kämmen etc.
Der erste Theil des Patents bezieht sich auf zwei Maschinen, wovon die eine besonders
zur Vorbereitung kurzer Faserstoffe, die andere zur Bearbeitung aller Gattungen von
Stoffen sich eignet. Beide haben übrigens den Zweck, die Locken bei gehöriger
Schonung der Faser auf eine wirksamere Weise zu öffnen und zu reinigen, als dieses
durch den gewöhnlichen Wolf geschieht.
Der zweite Theil der Erfindung betrifft die Krempelmaschine und besteht in der
Anbringung eines Walzenpaares vorn an den gewöhnlichen Speisewalzen, die jedoch
etwas langsamer rotiren, wodurch das Material, ehe es in die Maschine tritt, in
gewissem Grade gestreckt wird.
Fig. 5 stellt
die Maschine zum Vorbereiten kurzer Faserstoffe im
senkrechten Längendurchschnitte dar. a ist das
Maschinengestell; b die Treibwelle, welche mit einem
Getriebe versehen ist, das vermittelst eines Systems von Rädern und Getrieben eine
der beiden Walzen g, g, über welche ein endloses Tuch
h, h läuft, in Rotation setzt. Zwei Walzen i, i, wovon die eine durch Hebel und Gewichte auf die andere
herabgedrückt wird, sind in Schlitzen gelagert, und werden von der Welle b aus durch ein System von Rädern in Umdrehung Gesetzt.
Unmittelbar vor den Walzen i befinden sich drei andere
Walzen j, j, j, deren obere mit Hülfe belasteter Hebel
k auf die beiden unteren herabgedrückt wird. Alle
drei Walzen rotiren mit gleicher Geschwindigkeit, und das sie in Bewegung setzende
Räderwerk ist so berechnet, daß ihre Peripheriegeschwindigkeit etwas größer ist als
die der Walzen i, wodurch eine streckende Wirkung
entsteht.
An der Vorderseite der Walzen j ist ein rotirender
Schläger angeordnet, bestehend aus einem mit Schlagarmen l,
l versehenen Metallcylinder c. Dieser Schläger
ist oben von einem cylindrischen Mantel d, unten zum
Theil von einem Gitter oder Rost m umgeben, und wird
mittelst eines endlosen Riemens von der Welle b aus in
Rotation Gesetzt.
An der Achse des Schlägers befindet sich eine Rolle, welche mittelst eines Riemens
die Achse n eines von einem concentrischen Gehäuse
umgebenen Ventilators mit breiten Flügeln o, o in
Bewegung setzt. p ist eine luftdichte Kammer mit
gitterförmigen Boden p*, dessen Oeffnungen mit einer
Kammer zur Aufnahme von Staub und andern Unreinigkeiten communiciren. In der Kammer
sind zwei Cylinder q, q aus siebartig durchlöchertem
Metallblech oder Drahtgewebe angeordnet, deren Achsen von der Hauptwelle b aus in langsame Rotation Gesetzt werden. Unterhalb
dieser Cylinder befindet sich ein Luftverdünnungsventilator r, innerhalb eines Gehäuses s, s, welches zu
beiden Seiten mit einer Oeffnung s* versehen ist, die
mit der Kammer p communicirt.
Die Operation der Maschine ist nun folgende. Die auf gewöhnliche Weise sortirte Wolle
wird glatt auf das Zuführtuch h gelegt, und durch dieses
den Walzen i zugeführt, welche sie den Streckwalzen j übergeben. Durch diese Walzen wird die Wolle zum Theil
aus einander gezogen und gerade gerichtet, so daß sie sich leichter durch den
Schläger c, l bearbeiten läßt. Indem nun der letztere
mit großer Geschwindigkeit rotirt, öffnet er die verwirrten Locken, schlägt sie auf
das Gitter m herab und sondert viel Unreinigkeiten und
fremdartige Substanzen von ihnen ab, welche durch die Zwischenräume des Gitters in
den darunter befindlichen Behälter fallen. Der Ventilator o aber öffnet die verwirrten Locken noch weiter und treibt sie das
geneigte Gitter p* hinauf. Indem ferner der
Luftverdünnungsapparat r die Luft aus der Kammer p herbeizieht, veranlaßt er die geöffnete Wolle auf den
Peripherien der
siebartig durchlöcherten Cylinder q, q sich anzuhäufen,
wobei Staub und andere Unreinigkeiten theils durch das Gitter p* in den darunter befindlichen Behälter fallen, theils mit der Luft durch
die Löcher der Cylinder und die Oeffnungen s* ins Freie
getrieben werden. Die gereinigte Wolle fällt auf das geneigte Brett t, um nachher weiter verarbeitet zu werden. Damit die
Wolle nicht an die Cylinder festgesaugt und dadurch ihre Ablösung von denselben
erschwert werde, sind die Blöcke y, y vorgerichtet.
Diese Blöcke sind an Naben befestigt, welche lose an den Cylinderachsen sitzen und,
durch die Seitenwand sich erstreckend, an das Maschinengestell befestigt sind.
Die zweite Maschine ist Fig. 6 im Grundriß und
Fig. 7 in
der Seitenansicht dargestellt. a ist das
Maschinengestell, b die Treibwelle, welche eine Rolle
c enthält, von der vermittelst eines Riemens die
Rotation einer Querwelle d mitgetheist wird. An dieser
Welle befinden sich vier Kurbeln e, welche durch Stangen
f mit Hebeln g in
Verbindung stehen, die um die Stützpunkte h oscilliren.
Jeder Hebel g enthält eine kleine Rolle i und diese ist mit einer Hülse versehen, woran ein
Schläger j (eine Art Dreschflegel) befestigt ist. An
jede dieser Rollen sind zwei Riemen k befestigt, welche
in entgegengesetzter Richtung auf dieselben gewunden, und mit ihren andern Enden an
das Maschinengestell befestigt sind. Solcher Stangen f*,
Hebel g*, Rollen i* und
Schläger j* enthalten die Kurbeln e noch mehrere. Auf jeder Seite des Maschinengestells befindet sich eine
cannelirte Walze l, deren Rinnen ein System endloser
Schnüre m aufnehmen, welche auch unter den Leitwalzen
n hinweggehen. Diese Schnüre bilden eine biegsame
und offene Fläche, auf welcher die Wolle durch die Schläger j geklopft wird. An der Achse einer der Rollen l ist ein Getriebe o befestigt, welches in ein
anderes an der senkrechten Welle q befestigtes Getriebe
p greift. Ein an dem unteren Ende der Welle q befindliches Getriebe greift in ein anderes an der
horizontalen Achse r befestigtes Getriebe. Die Achse r enthält ferner ein Schraubenrad, welches in eine an
der Achse d befindliche Schraube greift. Durch diese
Anordnung wird die Walze l mit ihren endlosen Schnüren
in Rotation Gesetzt. Die mit Einschnitten versehenen Querstücke s haben den Zweck, den Schnüren m eine Unterlage darzubieten und sie aus einander zu halten, so daß sie
ein regelmäßiges Gitter bilden.
Fig. 8 stellt
einen der Schläger und sein unmittelbares Zugehör in einer besonderen Ansicht dar.
Angenommen die Theile befinden sich in der durch feine Punktirung angedeuteten Lage
und die Welle d
werde in der Richtung
des Pfeils in Rotation Gesetzt, so dreht sie durch Vermittelung der Kurbel e und der Lenkstange f den
Hebel g um seinen Stützpunkt h, wodurch auch der Schläger j vorwärts
gezogen wird, bis sich der Riemen k in ausgespannter
Lage befindet. Diese Stellung der Theile ist durch die ausgezogenen Linien
dargestellt.
Die weitere Rotation der Kurbel und daraus hervorgehende Oscillation des Hebels g veranlaßt den nunmehr angespannten Riemen k, die Rolle i in rasche
Umdrehung zu setzen, wodurch der Schläger in die durch die starken punktirten Linien
bezeichnete Lage gebracht wird. Die fortwährend sich drehende Kurbel e zieht nun den Schläger in eine beinahe horizontale
Richtung zurück, bis der Riemen k¹ in
ausgespannter Lage sich befindet, worauf der Schläger j
wieder in seine ursprüngliche Stellung bewegt wird u.s.w. In Fig. 7 sind vier auf dem
Umfang der Welle vertheilte Kurbeln, von denen jede zwei Schläger auf den
entgegengesetzten Seiten der Maschine in Thätigkeit setzt, dargestellt, eine
Anordnung welche eine rasche Aufeinanderfolge von Schlägen darbietet. Der zu
öffnende und zu reinigende Faserstoff wird auf die endlosen Schnüre m gelegt; diese führen das Material langsam vorwärts und
bringen es unter die Schläger, welche die verworrenen Flocken öffnen, während Staub
und sonstige Unreinigkeiten zwischen den Schnüren hindurch in einen darunter
befindlichen Kasten fallen. Das aufgelockerte und gereinigte Material wird an der
andern Seite der Maschine zur weiteren Bearbeitung in Empfang genommen. Das
elastische Kissen y hat den Zweck, den Stoß bei der
Rückkehr der Schläger in ihre ursprüngliche Lage zu beseitigen. Die Seitenbretter
w, in denen für die Schläger j Schlitze gelassen sind, verhüten das Abgleiten der Wolle von den
Schnüren.
Die Verbesserung an Krempelmaschinen ist Fig. 9 im Durchschnitte
dargestellt. a, a sind die gewöhnlichen Speisewalzen,
b, b die beigegebenen Walzen, welche etwas langsamer
als die Walzen a, a rotiren und dadurch das Material
zurückhalten, wodurch das letztere einen gewissen Grad der Streckung erfährt, bevor
es in die Krempelmaschine gelangt.
Tafeln