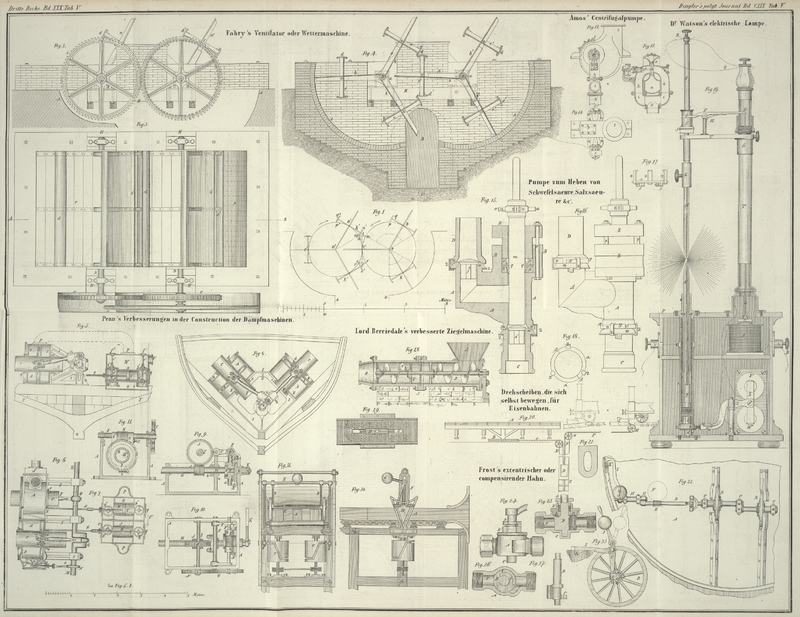| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Dampfmaschinen, von Hrn. Penn in London. |
| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. LXXVII., S. 322 |
| Download: | XML |
LXXVII.
Verbesserungen in der Construction der
Dampfmaschinen, von Hrn. Penn in London.
Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1853, S.
263.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Penn's Verbesserungen in der Construction der
Dampfmaschinen.
Schon vor längerer Zeit hat man vorgeschlagen, die Kolbenstangen der Dampfmaschinen
hohl zu machen, damit sie in dem Innern eine Kurbelstange aufnehmen können, welche
die Kraft und die Bewegung des Kolbens auf eine Kurbel an der Treibwelle überträgt,
auf dieselbe Weise wie dieß bei den direct wirkenden Dampfmaschinen der Fall
ist.
Das eine Ende der Kurbelstange ist durch ein Gelenk mit dem Kolben verbunden und zwar
ist dasselbe im Innern der hohlen Kolbenstange angebracht, während das andere Ende
wie gewöhnlich über die Kurbelwarze greift. Das erstere Ende hat daher eine
wiederkehrend geradlinige und das andere eine ununterbrochene drehende Bewegung. Die
Kurbelstange oscillirt also im Innern der hohlen Kolbenstange um den Bolzen, der sie
mit dem Kolben verbindet, und es muß daher die Kolbenröhre so weit seyn, daß die
schwingende Kurbelstange die Seitenwände bei ihrer schiefsten Stellung nicht
berührt.
Die Dimensionen, welche man folglich der Kolbenstange geben muß, haben jedoch einen
sehr bedeutenden Nachtheil, nämlich den, daß sie einen großen Raum im Innern des
Cylinders einnimmt, wodurch der für die Wirkungsoberfläche des Dampfs auf den Kolben
bleibende Raum sehr vermindert wird, daher der Dampfdruck auf der einen Seite des
Kolbens größer als auf der andern ist.
Man hat diesem Nachtheil dadurch abzuhelfen gesucht, daß man der hohlen Kolbenstange,
statt einer cylindrischen Form des Querschnitts, eine oblonge Form gab, die der ganzen
Länge der Stange nach zwei ebene Flächen darbot, welche durch zwei halbkreisförmige
Enden vereinigt wurden und daher in dem Innern der Röhre den ganzen Raum darbieten,
welcher zur Bewegung der Kurbelstange in der Längenrichtung erforderlich ist, in der
Breite aber nur einen solchen Raum, der zur freien Bewegung der Kurbelstange
zwischen den beiden Wänden hinreicht. Die Stopfbüchse in dem Cylinderdeckel muß
natürlich genau dem Querschnitte der Kolbenstange entsprechen.
Hr. Penn schlägt vor, die
Kolbenstange auch auf der entgegengesetzten Seite des Kolbens zu verlängern, so daß
beide Seiten des Kolbens dem Dampf eine gleiche Fläche darbieten, indem die
Verlängerung der Stange zu beiden Seiten des Kolbens einen gleichen räumlichen
Inhalt abschneidet. Diese Einrichtung sichert auch die geradlinige Bewegung des
Kolbens, und überdieß ist die innere Gelenkverbindung der Kolbenstange mit dem
Kolben auf diese Weise viel zugänglicher.
Die Figuren 5
bis 11
stellen verschiedene Ansichten, Anwendungen und einzelne Theile der Penn'schen Erfindung dar.
Fig. 1 zeigt
einen Querdurchschnitt von den Seitenwänden eines Schiffs mit seiner
Dampfmaschine.
A ist der Cylinder und B der
Kolben; C stellt die hohle Kolbenstange dar, welche eben
so gut einen kreisförmigen als einen länglich vierseitigen Querschnitt haben kann.
F ist die Kurbelstange, welche um die Achse a im Innern des Kolbenrohres C schwingt, und deren anderes Ende mit der Warze b der Kurbel G, welche die Welle H bewegt, verbunden ist.
Man sieht, daß die Kolbenstange C durch den Deckel E des Cylinders mittelst einer Stopfbüchse e geht und ihre Verlängerung durch den Boden D mittelst einer andern Stopfbüchse d. Beide Stopfbüchsen führen die hohle Stange, und der
Kolben B wird also der Art während seiner Bewegung
gehalten, daß er auf der innern Oberfläche des Cylinders überall gleiche Reibung
hat.
Cylinder dieser Art können horizontal gelegt werden, wie es in der obigen Figur der
Fall ist, sie können aber auch senkrecht stehen. Die horizontale Lage ist bei
Schrauben-Dampfschiffen eine sehr vortheilhafte; sie gestattet die Hauptwelle
für die Kurbeln und die Achse der Schraube in eine gerade Linie zu legen, so daß die
eine die Verlängerung der andern bildet, und die Bewegung folglich direct und ohne
Zwischenkunst eines Räderwerks erfolgt.
Ein Beispiel davon gibt unsere Fig. 1; die gesammte
Maschinerie kann unter das erste Deck und unter die Wasserlinie des Schiffes gelegt
werden.
I ist ein Gestell, welches die Welle H trägt; dieselbe ist mit zwei Kurbeln versehen, welche
zwei neben einander angebrachte Maschinen treiben, wie Fig. 2 zeigt, welche ein
Grundriß und zum Theil ein horizontaler Durchschnitt ist.
Diese Welle H bewegt sich in Lagern auf dem Gestell I, welches aus drei Theilen besteht, wovon zwei an den
Böden E der beiden Cylinder befestigt sind, während der
dritte Theil in der Mitte liegt und zugleich zur Verbindung beider Cylinder
dient.
Der vordere Theil der hohlen Kolbenstange C besteht mit
dem Kolben selbst aus einem Stück, während der andere Theil mit dem Kolben mittelst
eines vorstehenden Randes und Schrauben verbunden, das Ganze aber in dem Kolben
eingelassen ist.
Die Achse a, um welche die Kurbelstange schwingt, ist
mittelst Schraubenbolzen Z an einer Scheibe befestigt,
die im Innern des Kolbenrohres angebracht und in der Mitte ausgeschnitten ist, um
die Kurbelstange durchzulassen.
Man sieht, daß der Dampfvertheilungsschieber M, welcher
durch das Excentricum N bewegt wird und in der
Vertheilungsbüchse f eingeschlossen ist, dieselbe
Einrichtung wie bei den gewöhnlichen Dampfmaschinen hat.
Die Röhre P, in Fig. 5 in punktirten
Linien angegeben, führt den Dampf nach dem Condensator. Diese Anordnung ist nur dann
anwendbar, wenn der Condensator dem Dampfcylinder gegenüber liegt und die Luftpumpe
horizontal im Innern des Condensators angebracht ist, wie in Fig. 5 und 7.
Es ist eine bequeme Einrichtung, die Luftpumpe direct durch den Dampfkolben mittelst
der horizontalen Stange S zu betreiben, welche mit
diesem Kolben verbunden ist und durch den Cylinderdeckel E mittelst einer Stopfbüchse geht. Jedoch kann man die Luftpumpe im Innern
des Condensators auf verschiedenartige Weise anbringen und sie nach einer der
gewöhnlichen Methoden bewegen.
Fig. 8 bietet
ein anderes Beispiel der Anwendung hohler Kolbenstangen bei zwei Dampfcylindern dar;
beide Kolben wirken auf eine einzige Kurbel G, die an
der Treibwelle H angebracht ist. Die beiden Cylinder
sind sehr zweckmäßig an entgegengesetzten Seiten des Schiffes angebracht, so daß
ihre Centrallinien unter 45° geneigt sind und beide einen rechten Winkel
einschließen. Sie können dann wechselseitig auf die Warze b
derselben Kurbel G wirken, und auf diese Weise eine stetige Bewegung
hervorbringen, d.h. die Welle H regelmäßig drehen, wie
es zwei parallel zu einander angebrachte Cylinder thun würden, deren Kolbenstangen
auf zwei rechtwinkelig zu einander stehende Kurbeln wirken.
Die geneigte Stellung der beiden Cylinder gestattet, die Maschinen in einem engen
Raume des Schiffes und näher dem Hintertheile desselben anzubringen, als es bei
horizontal liegenden Cylindern möglich wäre; denn letztere beanspruchen mehr Raum
als der enge Hintertheil eines Schiffes bieten kann.
Die Cylinder nehmen in dem vorliegenden Falle weniger Platz ein, und es wird auch die
Welle H kürzer, weil nur eine Kurbel statt zweier
vorhanden ist, und überdieß die Maschinen dem Hintertheile des Schiffs und folglich
der Triebschraube näher liegen. Ein Cylinder muß dem Hintertheil näher angebracht
seyn als der andere, weil die eine Kurbelstange hinter der andern die Warze b angreifen muß.
Ein anderer Theil der Verbesserungen des Hrn. Penn bezieht sich auf die Luftpumpen oder
vielmehr auf deren Ventile, in dem Fall wo diese Pumpen horizontal liegen. Das
System der Luftpumpen mit massiven Kolben, also doppelt-wirkend, und mit vier
an den Enden angebrachten Ventilen, zwei für den Eintritt und zwei für den Austritt,
ist bekannt; die auf diese Ventile bezüglichen Verbesserungen bestehen darin, jedes
Ventilpaar der Art anzubringen, daß ein Einlaßventil genau unter einem Auslaßventil
befindlich ist, damit eine und dieselbe Leitstange für beide dienen und die Sitze
beider Ventile in ihren respectiven Stellungen in dem ausgehöhlten Theil am Ende des
Pumpenkörpers festhalten kann. Wenn man die Leitstangen weggenommen hat, so sind die
Ventile frei, und man kann sie zur Untersuchung oder Reparatur herausnehmen; die
Ventilsitze können ebenfalls aus ihren Vertiefungen herausgenommen werden, um sie
mit andern zu vertauschen.
Fig. 5 zeigt
den senkrechten Durchschnitt des Condensators und der Luftpumpe, und Fig. 7 ist ein
horizontaler Durchschnitt davon.
Q ist ein metallener Behälter, welcher als Condensator
und als Warmwasserbehälter dient; er ist mit einem verticalen Scheider j, Fig. 7, versehen, der im
Behälter Q zwei Abtheilungen bildet, welche als zwei
getrennte Condensatoren für die beiden Maschinen dienen.
Die Pumpenkörper R, welche sich horizontal durch jede
Abtheilung erstrecken, haben eine Oeffnung an jedem Ende, von denen die eine durch
eine Thür q, die andere durch einen Deckel r verschlossen ist. Der Deckel r hat eine Stopfbüchse, durch welche die Stange S geht.
Außerdem ist der innere Raum des Behälters Q am Umfang
des Pumpenkörpers mittelst eines horizontalen Scheiders getheilt, welcher in der
Figur nicht dargestellt ist und sich ungefähr im Niveau des obern Theils eines jeden
Pumpenkörpers R befindet; der Raum unterhalb dieses
Scheiders bildet den eigentlichen Condensator; der darüber befindliche Raum W dient als Warmwasserbehälter, in welchen die Luftpumpe
das Wasser und die Luft welche sie aus dem Condensator zog, ausströmen läßt. Das
überflüssige Wasser fließt durch das Rohr V ab.
a' sind die Einlaß- und b' die Auslaßventile; c' und d' sind ihre betreffenden Sitze; a' ist die Leitstange, welche oben an einem Deckel f' befestigt ist, der auf ein Loch im obern Theil des Warmwasserbehälters
geschraubt ist. Diese Stangen haben an ihrem Umfange Verstärkungen, durch welche sie
die Ventilsitze an ihrem Platze erhalten. Die Stangen e'
gehen durch die Ventile hindurch und letztere können sich an ersteren bis an die aus
Fig. 5
ersichtlichen Vorsprünge vertical aufwärts bewegen.
Wenn man den Deckel f' abhebt und die Ventilstange e' herauszieht, so sind die Ventile und ihre Sitze frei,
und man kann sie aus dem Apparat durch die Thür q oder
durch den Deckel r, sowie durch eine entsprechende Thür
des Warmwasserbehälters W herausnehmen.
Diese Ventilstangen liegen übrigens nicht genau in der Centrallinie der Pumpe,
sondern etwas seitwärts der Kolbenstange S.
Hr. Penn hat noch eine dritte
Verbesserung in der Construction der Schiffs-Dampfmaschinen gemacht, deren
Zweck hauptsächlich in einer Verminderung der Reibung und der Abnutzung besteht,
welche am innern Ende der horizontalen Schraubenachse stattfinden. Dieses Ende der
Achse drückt, während die Achse sich zugleich schnell dreht, sehr stark gegen einen
festen Punkt des Schiffes und überträgt die ganze von der Treibschraube entwickelte
Kraft. Man erreicht diesen Zweck durch Anwendung einer ebenen Scheibe von gehärtetem
Stahl, an der Stelle, wo die Berührung des platten Endes der Treibwelle stattfindet,
welches ebenfalls aus gehärtetem Stahl besteht. Diese Scheibe erhält durch einen
unten beschriebenen Mechanismus eine langsame drehende und bezüglich der
Schraubenachse excentrische Bewegung, welche letztere daher während ihrer schnellen
Drehung fortwährend mit anderen Punkten der ebenen Scheibe in Berührung kommt.
Fig. 9 ist ein
Längendurchschnitt des Apparates, Fig. 10 ein horizontaler
Durchschnitt, und Fig. 11 ein Querdurchschnitt durch das Ende.
A ist ein gußeiserner, gut befestigter Kasten. H ist die Verlängerung der Treibschraubenwelle, welche
sich gegen die Scheibe von gehärtetem Stahl B stützt;
die Scheibe ist mit dem Schraubenrade D fest
verbunden.
Das Rad hat auf der entgegengesetzten Seite von der Scheibe B einen kreisförmigen Vorsprung e, welcher
sich in der Pfanne f dreht. Ein Bolzen g kann in der mittlern Oeffnung des Rades D angebracht werden, um dasselbe bei seiner Drehung
vollständiger zu unterstützen. Das Rad D steht
excentrisch bezüglich der Treibwelle H, und die Pfanne
f, in welcher sich das Rad D dreht, ist mit dem Arme k verbunden, der
durch die Wand des Kastens geht und wieder excentrisch bezüglich der Pfanne steht.
Die Excentricität des Rades D bezüglich der Treibwelle
H, und die der Pfanne f'
bezüglich des Arms oder der kurzen Welle k sind übrigens
der Art, daß sie sich neutralisiren können, d.h. wenn man mit Hülfe des Hebels K die Pfanne um 180° gedreht hat, indem man von
der in Fig.
10 angegebenen Lage ausgeht, die Treibwelle H
und das Rad D concentrisch liegen. Wenn man demnach dem
Hebel Zwischenlagen gibt, so kann man jeden beliebigen Grad der Excentricität der
Scheibe B herstellen.
Eine endlose Schraube j auf der Treibwelle H greift in ein Schraubenrad J auf der Welle I. Diese Welle trägt ein
Zahnrad N, welches in ein anderes G eingreift, auf dessen Welle F eine andere
endlose Schraube E sitzt, die das Schraubenrad D bewegt.
Man begreift, daß die drehende Bewegung dieses letztern Rades im Verhältniß zu
derjenigen der Treibwelle H wegen des angewendeten
Räderwerks eine sehr langsame seyn muß.
Damit bei einer Aenderung der Excentricität des Rades D,
mittelst des Hebels K, die endlose Schraube E in die Zähne dieses Rades einzugreifen fortfährt, läßt
man die Welle F von zwei Armen r tragen, die um die feste Welle S drehbar
sind und zugleich bewirken, daß das Rad G ungeachtet
seiner Lagenveränderungen stets mit dem Rade N in
Eingriff bleibt. Diese Welle wird durch die beiden Arme horizontal erhalten und die
endlose Schraube E kann auf derselben hingleiten,
während sie durch einen Vorstecker verhindert wird sich um dieselbe zu drehen.
Zwei starke Ringe t, welche die Verlängerungen der beiden
durch Schraubenbolzen x verbundenen Hälften eines Ringes
U bilden, der die Pfanne f umfaßt, halten die endlosen Schrauben E
zwischen sich, umfassen die Welle F, und können allen
Bewegungen sowohl der horizontalen der Schraube, als der verticalen Bewegung der
Welle F folgen.
Die Treibwelle H liegt nahe ihrem Ende in einem Lager b, welches in einer Oeffnung der im Kasten A befindlichen Scheidewand a
angebracht ist.
Letztere Verbesserungen können mit geringen Abänderungen bei Mühlwellen und in allen
den Fällen angewandt werden, wo die Enden der Wellen in Folge starken Druckes und schneller Rotation
bedeutender Erhitzung oder Abnutzung ausgesetzt sind.
Tafeln