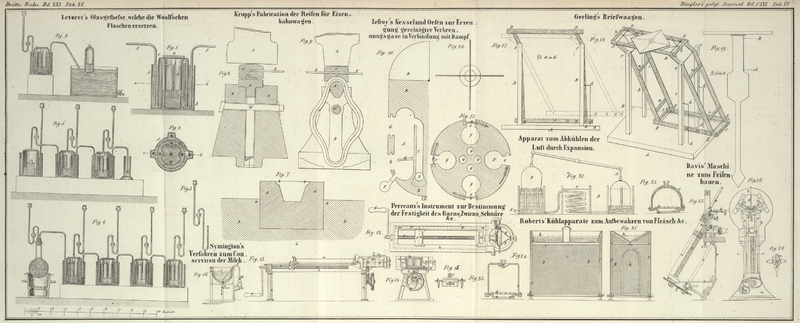| Titel: | Kessel und Oefen zur Erzeugung gereinigter Verbrennungsgase in Verbindung mit Dampf, für den Maschinenbetrieb; erfunden von Hrn. Lefroy zu Devonport. |
| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. C., S. 411 |
| Download: | XML |
C.
Kessel und Oefen zur Erzeugung gereinigter
Verbrennungsgase in Verbindung mit Dampf, für den Maschinenbetrieb; erfunden von Hrn.
Lefroy zu
Devonport.
Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Oct. 1853,
S. 341.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Lefroy's Generator für Dampfmaschinen.
Fig. 10
stellt einen Theil von dem senkrechten Durchschnitt und Fig. 11 einen
horizontalen Durchschnitt eines solchen Kessels mit Oefen dar, in denen alle gasigen
Verbrennungsproducte des Brennmaterials zu dem Boden des Kessels strömen, von dort
durch das Wasser (in welchem alle Unreinigkeiten die sie aus dem Ofen mitbringen,
abgesetzt werden) emporsteigen, mit Dampf gesättigt werden und so in den
Treibcylinder gelangen. Die Gastheilchen dienen zum Uebertragen des Wärmestoffs in
das Wasser, statt daß sie ihn jetzt durch die Platten und Röhren des Kessels in das
Wasser ausstrahlen. In Fig. 10 ist A der Ofen; B das Wasser;
C die Gasröhre; D der
Behälter von gereinigten Gasen und Dampf; E ein
schwimmendes Kugelventil; F Röhre für verdichtete
(Gebläse-) Luft; G, G Oeffnungen zum Einfeuern;
H mit Wasser angefüllte Roststäbe; I Röhre zum Abführen der Unreinigkeiten. In Fig. 11 sind
F die Oefen; G, G die
Gasröhren; D, D die mit Wasser angefüllten
Schieberthüren; S, S die Feuerungsöffnungen. Der Ofen
ist geöffnet dargestellt, so daß geschürt werden kann, und das schwimmende
Kugelventil als die Gasröhre verschließend. Der Wind wird abgesperrt, indem man
diejenige Röhre schließt, welche jeden Ofen (es sind ihrer vier) mit der
kreisförmigen Hauptröhre F verbindet.
Die Vortheile, welche solche Kessel und Oefen darbieten, sind folgende: 1) eine große
Brennmaterial-Ersparung, welche man theils dadurch erzielt, daß eine absolut
größere Wärmemenge aus einer gegebenen Brennmaterial-Menge entwickelt wird,
theils dadurch, daß derjenige Theil der Wärme benutzt wird, welcher jetzt mit den
Gasen als freier Wärmestoff in die Esse ausströmt; 2) Ersparung an Anlagekosten des
Apparates, der kleiner und leichter ist, auch eine größere Dauerhaftigkeit besitzt.
Seine Größe kann deßhalb vermindert werden, weil weniger Steinkohlen zu einem
gegebenen Zweck verbrannt werden und die Verbrennung eine raschere ist.
Die Dauerhaftigkeit des Apparats ist viel größer, weil kein Theil des Kessels der
directen Einwirkung des Ofens ausgesetzt ist. Da wahrscheinlich neun Zehntel des
elastischen Gemisches, welches durch die Cylinder strömt, aus Dampf bestehen, so
wird die Condensation immer noch mit Vortheil angewendet werden können,
vorausgesetzt daß man eine größere Luftpumpe als jetzt benutzt. Eine von dem
Erfinder angestellte Berechnung ergibt 2,630,767 Pfund 1 Fuß hoch gehoben als das
Maaß der Spannkraft der Gase, welche 1 Pfd. Anthracit-Kohle durch die
Verbrennung erzeugt, nach Abzug des Aequivalents der eingepreßten Luft, welche zur
Unterhaltung der Verbrennung dient, und unter der Annahme, daß aller durch die
Verbrennung entweichende Wärmestoff von den Gasen zurückgehalten wird. Obgleich nun,
wie schon oben bemerkt wurde, bei weitem der größte Theil des Wärmestoffes zur
Erzeugung von Dampf verwendet wird, indem die Gase einfach die Wärme in das Wasser
führen, so wird dennoch, da das Volum dieser Gase mehr als das Dreifache von dem zu
ihrer Erzeugung erforderlichen Luftvolum (von gleicher Temperatur und demselben
Druck) ist, und weil aller entwickelte Wärmestoff entweder von den Gasen
zurückgehalten, oder von dem Wasser aufgenommen werden muß (und in beiden Fällen zu
der erzeugten und benutzten Gesammt-Spannkraft beiträgt), bedeutend mehr
Kraft gewonnen als bei den anderen Generatoren.
Die Feuerthüren G können durch Schieber verschlossen
werden, die hohl und mit Wasser gefüllt sind, indem man sie mit dem Kessel durch
zwei enge Röhren, die durch Stopfbüchsen gehen, in Verbindung setzt.
Der Erfinder nennt einen nach seinem System construirten Treibapparat für Schiffe
„Fumific propeller“.
Tafeln