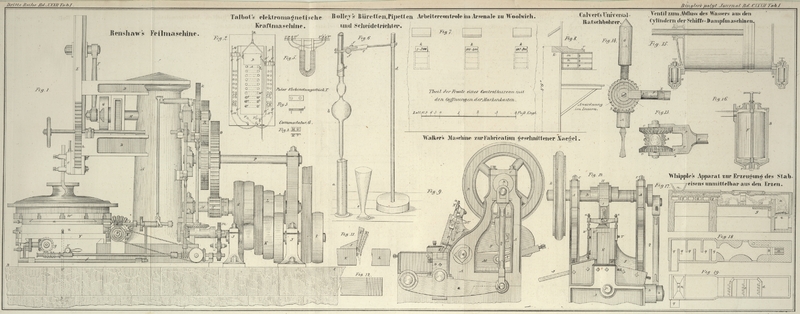| Titel: | Der Mohr'sche Quetschhahn in veränderter Anwendung auf die Fertigung von Büretten, Pipetten und Scheidetrichtern; von Dr. Bolley. |
| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. XII., S. 52 |
| Download: | XML |
XII.
Der Mohr'sche Quetschhahn in veränderter Anwendung auf
die Fertigung von Büretten, Pipetten und Scheidetrichtern; von Dr. Bolley.
Aus dem Schweizerischen Gewerbeblatt, October
1853, S. 289.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Bolley, über der Mohr'sche Quetschhahn.
Der bekanntesten Form der Bürette, der Gay-Lussac'schen mit kanneartigem Ausgußrohr, kleben einige wesentliche
Fehler an, auf welche Dr. Mohr (in der vorhergehenden Abhandlung) aufmerksam gemacht hat.
Ich halte deren Zerbrechlichkeit und die Schwierigkeit, sich das Instrument selbst leicht herzustellen, für die wichtigsten
Schattenseiten desselben.
Weniger erheblich erscheint mir der Vorwurf, daß das Instrument während des
Ausgießens geneigt werden müsse, und darum ein Ablesen
der verbrauchten Flüssigkeitsmengen während des Gebrauchs nicht möglich sey. Man ist
aber selten in der Lage, eine bestimmte Anzahl Kubikcentimeter etc. Flüssigkeit aus
der Bürette ausgießen zu müssen, sondern man gießt langsam aus, bis die gewünschte
Reaction eintritt, und liest nachher ab, wie viel man abgegossen hat.
Dr. Mohr empfiehlt ein
calibrirtes Rohr, unten spitz ausgezogen, mit an der Spitze befestigtem
Kautschukrohr, an dem eine Klemmvorrichtung angebracht ist, durch die das
Kautschukrohr beliebig geöffnet und zugeschlossen werden kann. In der Ruhe ist das
Rohr geschlossen, bei einem Druck öffnet es sich.
Die Bedenken, welche sich gegen diese Vorrichtung erheben können, sind: 1) dieselbe
ist nicht viel leichter herzustellen, als die gewöhnliche Bürette; 2) zwischen der
Glasspitze in dem Kautschuk kann sich Flüssigkeit ansetzen, von welcher der Apparat
schwer zu reinigen seyn möchte, so daß nothwendig erscheint, für verschiedene
Probeflüssigkeiten verschiedene Büretten zu halten; 3) wird Kautschuk von einzelnen
der gebrauchten Titrirflüssigkeiten angegriffen.
Bei der Mohr'schen Vorrichtung halte ich namentlich die
Idee des „Quetschhahns“ für eine der mannichfaltigsten und
annehmlichsten Anwendungen fähige.
Ich überzeugte mich, daß nicht nur wasserdichter, sondern
auch luftdichter Verschluß durch den Mohr'schen Hahn erreicht werden kann, wenn das
Kautschukrohr etwas dickwandig ist und die federnde Kraft der Klemmvorrichtung stark
genug ist. Enge Kautschukröhren sind am leichtesten vollständig durch Klemmen zu
verschließen. Dreht man die Klemmzange um 90–120° ihrer Achse, so daß
das Kautschukrohr einen scharfwinkeligen Bug bekommt, so wird der luftdichte
Verschluß bei jeder Röhre erreichbar.
Wird ein passendes Kautschukrohr an das obere Ende der Saugöffnung einer gewöhnlichen
Pipette mit cylindrischem oder kugeligem Bauch angebracht und in die Klemmzange
eingehängt, so kann derselbe durch Oeffnen der Zange (des Quetschhahns) und Ansaugen
gefüllt werden. Zieht man das untere Ende des Hebers bis zur passenden Enge der
Mündung aus, so läßt sich ganz leicht bewirken, daß bei verschlossenem Hahn kein
Tropfen ausfließen kann. Ich habe 20 Minuten lang in einem Raum von der Temperatur
der probirten Flüssigkeit solche in der Pipette erhalten, ohne daß ein Tropfen
abfloß. Die Probeflüssigkeit bringe ich, will ich die beschriebene Vorrichtung im
Sinne der Bürette gebrauchen, in einen Meßcylinder a, Fig. 6, darüber die
Pipette b hängend in der Klemmzange c, die am Stativ d befestigt
ist. Durch Druck auf die Knöpfe f wird die Zange
geöffnet, sodann der Saugapparat in die Flüssigkeit gesenkt und von solcher so viel
angesogen, als die Pipette faßt, letztere wieder senkrecht daraus in die Höhe
gezogen und hängen gelassen, bis nichts mehr abtropft. Darneben, so daß der einen
Kreis beschreibende Arm c des Stativs die Pipette b bei einer Drehung von etwa 30° senkrecht
darüber bringt, ist die zu probirende Flüssigkeit im Glas e gestellt. Der Hahn wird durch Druck geöffnet, und schneller oder
langsamer, was ganz willkürlich erreicht werden kann, Flüssigkeit aus b nach e laufen gelassen.
Ist die gewünschte Reaction eingetreten, so wird die Pipette wieder seitlich bis
über b bewegt und auslaufen gelassen. Wiederablesen des
Flüssigkeitsstandes in a gibt sehr leicht die Menge der
verbrauchten Probeflüssigkeit. Daß, wie bei den „à écoulement“ titrirten Büretten der
hängenbleibende Tropfen in Abzug gebracht werden kann, sowie was vorzunehmen ist,
wenn einmalige Füllung der Pipette b nicht hinreicht,
bedarf keiner weiteren Erwähnung.
Der Apparat ist in der Handhabung eben so bequem als sicher, was ihn aber in meinen
Augen besonders schätzenswerth macht, ist: daß er aus Gegenständen leicht
zusammengefügt werden kann, die sich ohnedieß in jedem, auch ärmeren Laboratorium
befinden.
Auch bei der Saugpipette thut der Hahn sehr gute Dienste, da er viel bequemer ist,
als Verschluß mit der Zunge, während des Aushebens der Flüssigkeit. Scheidungen
zweier über einander stehender Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls leicht damit
vornehmen.
Tafeln