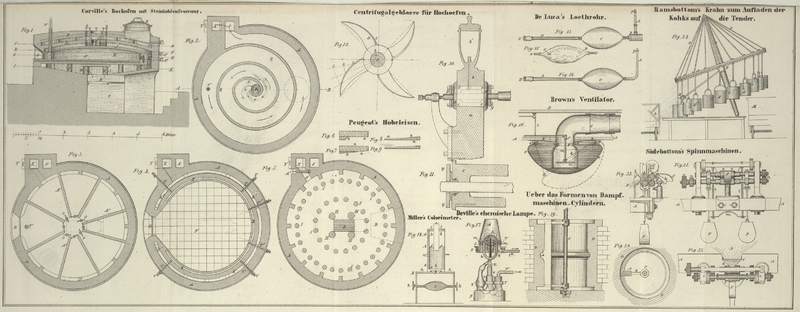| Titel: | Lampe zum Hervorbringen sehr hoher Temperaturen; von Hrn. Sainte-Claire Deville. |
| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. XXVI., S. 113 |
| Download: | XML |
XXVI.
Lampe zum Hervorbringen sehr hoher Temperaturen;
von Hrn. Sainte-Claire
Deville.
Aus den Comptes rendus, Decbr. 1853, Nr.
26.
Mit einer Abbildung auf Tab. II.
Deville's Lampe zum Hervorbringen sehr hoher
Temperaturen.
Mit der neuen Lampe, welche ich im Folgenden beschreibe und die im Laboratorium der
école normale zu Paris jetzt im täglichen
Gebrauch ist, kann man einen Platintiegel sehr schnell auf eine dem Schmelzpunkt des
Eisens nahe Temperatur bringen, indem man als Brennmaterial die jetzt sehr
verbreiteten flüssigen Kohlenwasserstoffe anwendet; auch Terpenthinöl kann man als
solches benutzen.
Bei dieser Lampe wird das Brennmaterial in Dampfform und angezündet gegen ein
Löthrohr mit sehr weiter Oeffnung geführt, dessen Wind der Blasebalg einer
Glasbläserlampe liefert.
Die Construction dieser Lampe ist übrigens sehr einfach; eine tubulirte Flasche
welche als Reservoir mit constantem Niveau dient, communicirt mit einem doppelten
Cylinder von Kupfer und erhält denselben mit Brennmaterial gefüllt. Die innere
cylindrische Hülle ist mit kleinen Löchern versehen, durch welche der brennbare
Dampf entweicht; und im Centrum des Apparates (der Lampe) befindet sich die Oeffnung
des Löthrohrs. In den ringförmigen Raum zwischen den zwei Cylindern und zwar an
dessen obern Theil, begeben sich zwei kupferne Röhren; diese verbinden sich unter
dem Apparat zu einer einzigen, welche mit einem Hahn versehen ist; eine (unter der
Lampe befindliche) Flasche mit zwei Tubulaturen setzt den Blasebalg mit dem Löthrohr
und dieser letztern Röhre in Verbindung. Die Lampe ist außen noch mit einer Rinne
versehen, in welche man Wasser gibt, damit sich ihre verschiedenen Theile nicht zu
stark erhitzen; überdieß wird auf der Lampe eine kupferne Kuppel angebracht, in
deren Loch man ein Zugrohr steckt, um die Flamme einzuziehen und
zusammenzuhalten.
Man erhitzt das erstemal das im cylindrischen Raum enthaltene wesentliche Oel, bis
das Wasser der Rinne ins Sieden kommt, gibt dann den Wind und zündet den nun
entstandenen Dampfstrahl an. Die während der Operation sich entwickelnde Wärme
reicht hernach zur Verdampfung des Brennmaterials hin.
Nach meinen Beobachtungen bringen diejenigen flüssigen Kohlenwasserstoffe, deren
Dampf die größte Dichtigkeit hat und deren Siedepunkt zugleich der niedrigste ist,
die stärkste Hitze hervor. Diese Thatsache ist leicht zu erklären, und um sich davon
zu überzeugen, braucht man nur mit den verschiedenen Arten von Oelen welche aus
Schiefern oder Steinkohlentheer abdestillirt werden, Versuche zu machen.
––––––––––
Hr. Moigno hat in seinem Cosmos, März 1854, S. 329, eine Abbildung dieser Lampe mitgetheilt, welche
Hr. Deville in der letzten Zeit zur Darstellung des
AlumiumsMan s. darüber polytechn. Journal Bd. CXXXI
S. 270. benutzte.
r, Fig. 17, Reservoir mit
drei Tubulaturen, in welches man die Luft durch die Röhre V eintreibt, die in der Tubulatur T befestigt
ist und mit einem Blasebalg in Verbindung steht.
t Tubulatur, in welcher eine verticale Röhre O befestigt ist, die mit einem Hahn R versehen ist, sich oben gabelförmig theilt und deren
zwei Schenkel b, b' dann in eine metallene Büchse L treten, wo ihre beiden offenen Enden bei m schief abgeschnitten sind. In der Büchse L befindet sich Terpenthinöl e, welches nicht ihre ganze Höhe einnimmt. Dieses wesentliche Oel gelangt
in die Büchse durch ein Rohr t'', das von einem
Reservoir mit konstantem Niveau ausgeht. Im Centrum der Büchse befindet sich eine
Röhre die unten geschlossen ist und das in der Mitte befindliche Löthrohr C umhüllt, welches die Fortsetzung der von der dritten
Tubulatur der Flasche F ausgehenden Röhre t' ist. Diese das Löthrohr umgebende Röhre ist an ihrem
oberen Theil mit mehreren kleinen Löchern u, u, u
versehen, welche mit dem leeren Theil U der Büchse L communiciren. Ueber dem Löthrohr ist in einer Nuth im
Deckel der Büchse eine kupferne Kuppel angebracht, in deren Mitte sich ein Loch
befindet, um den Gasstrom einzuziehen, welcher aus den Löchern u, u, u entweicht, nachdem man das in die Rinne oder
Schale S gebrachte Wasser a
bis zum Sieben erhitzt und dann den Blasebalg in Bewegung gesetzt hat, um Luft durch
die zwei Schenkel m, m der Röhre O in die Lampe zu treiben. Ueber der Büchse oder Lampe L befindet sich ein conisches Zugrohr A, welches am unteren Theil mit Oeffnungen versehen ist
und die Wirkung der Luft auf die Flamme des Apparats verstärkt. Das Spiel des
Löthrohrs ist leicht zu begreifen.
Tafeln