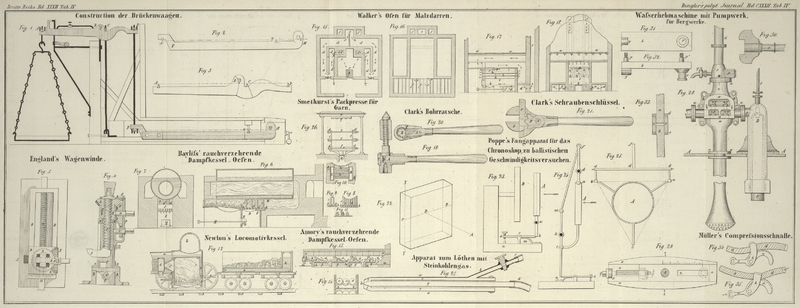| Titel: | Verbesserungen an rauchverzehrenden Dampfkesselöfen, welche sich Samuel Bayliß zu London, am 16. April 1853 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. LXIX., S. 245 |
| Download: | XML |
LXIX.
Verbesserungen an rauchverzehrenden
Dampfkesselöfen, welche sich Samuel
Bayliß zu London, am 16. April
1853 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, Februar 1854, S.
109.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Bayliß's Verbesserungen an rauchverzehrenden
Dampfkesselöfen.
Die Resultate, welche mit vorliegender Erfindung erzielt werden sollen, sind
folgende:
1) vollkommene Verbrennung der aus dem Brennstoff entwickelten Gase und Verzehrung
des Rauchs;
2) Zurückhaltung der Wärme, welche gewöhnlich unbenützt in den Schornstein
entweicht;
3) Erleichterung der Verdampfung, indem man in der Flüssigkeit eine rasche
Circulation erzeugt.
Um die chemische Verbindung der Gase mit dem Sauerstoff der Luft, d.h. ihre
Verbrennung zu bewerkstelligen, verzögert der Patentträger die Bewegung der Gase von
der Feuerstelle zum Schornstein dadurch, daß er sie in eine Anzahl feiner Ströme
theilt, und sie nöthigt sich mit der in feinen Strömungen aufsteigenden Luft zu
mischen.
Fig. 6 stellt
einen solchen Ofen im Verticaldurchschnitt dar. Die Stelle der gewöhnlichen
Feuerbrücke vertritt eine Luftkammer D, welche aus zwei
in den Seitenmauern des Ofens befestigten gußeisernen Platten E, F besteht. G ist eine an einer Platte E hängende Thür, welche mittelst der Stange H in Bewegung gesetzt wird und zur Regulirung des
Luftzutrittes dient. Der obere Theil der Platte E trägt
auf der einen Seite den Rost, auf der andern Seite die Stangen a, welche sich der Länge nach von einer Seite der
Luftkammer bis zur andern erstrecken, und dadurch an ihrer Stelle festgehalten
werden, daß sie in Schlitze, die zu ihrer Aufnahme vorbereitet wurden, eingesenkt
sind. Der obere Theil von F besteht aus einer eisernen
quer über den Ofen sich erstreckenden Platte, welche verhindern soll, daß die Luft
der Kammer D die Feuercanäle erreicht, ehe sie sich mit
den Gasen vermischt hat. c, c, c ist eine Reihe massiver
metallener oder thönerner Stäbe, welche der Patentträger „Mischer und
Wärmehalter“ nennt, zwischen denen sich Zwischenräume d von hinreichendem Inhalt befinden, um den
Verbrennungsproducten den Durchgang zu gestatten. Durch die Zwischenräume f strömt die Luft aus der Kammer D herauf und mischt sich mit den Gasen. Quer über den Ofen erstreckt sich
eine Brücke J, um zu verhüten, daß das Brennmaterial mit
den Mischern c, c, c in Berührung kommt. Aus der
vorstehenden Beschreibung erhellt, daß die Gase mit der Luft nothwendig in innige
Berührung kommen und sich mit derselben mischen müssen; und da die Stäbe c, c, c rothglühend werden und gewissermaßen ein
natürliches Wärmemagazin bilden, so findet von dem einen Ende der Mischer bis zum
andern eine stete Verbrennung statt.
Fig. 8 stellt
eine andere Construction der Mischungsstäbe im senkrechten Durchschnitte dar; der
Unterschied besteht darin, daß die Basis b mit Löchern
versehen ist, worin die senkrechten Stäbe c befestigt
sind.
Der Verticaldurchschnitt Fig. 9 zeigt eine dritte
Methode, welche sich von der letzten nur durch die an den Stangen c angebrachten Schultern g
unterscheidet.
Für Oefen von sehr hoher Temperatur dürfte sich das in Fig. 10 im
Verticaldurchschnitt dargestellte System vortheilhaft bewähren. Dasselbe besteht aus
zwei seitwärts eingemauerten schmiedeisernen Behältern L,
M, welche durch Metallröhren h, die als Mischer
dienen, mit einander verbunden sind. Eine Röhre N steht
mit der Druckpumpe und eine andere Röhre P mit dem
Kessel in Verbindung. Auf diese Weise nimmt alles Wasser, welches in den letzteren
tritt, durch die röhrenförmigen Mischer seinen Weg, absorbirt die Wärme und verhütet
das Verbrennen der Röhren. Diese Methode gewährt außerdem den Vortheil, daß das
Speisewasser vorgewärmt in den Kessel gelangt.
Der zweite Theil der Erfindung bezieht sich auf die Ausdehnung der Mischer und
Wärmehalter bis an das Ende des Kessels und erforderlichen Falles durch die innere
Röhre. Durch die vorüberstreichende Flamme und heißen Gase werden diese rothglühend
erhalten und geben durch Strahlung an den Kessel eine große Menge Wärme ab, welche
sonst nutzlos durch den Schornstein entweichen würde; sie bilden in der That ein
ununterbrochenes Feuer von dem einen Ende des Kessels bis zum andern, und haben das
Bestreben die Hitze gleichmäßiger durch den ganzen Ofen zu verbreiten. Für
Abdampfungspfannen, z.B. für Salzpfannen, wo eine
langsame Verbrennung und gleichmäßige Hitze unter der ganzen Oberfläche
wünschenswerth ist, hat sich dieser Theil der Erfindung als sehr nützlich
bewährt.
Der dritte Theil der Erfindung ist in Fig. 11 dargestellt. R, R ist ein Theil des Bodens eines Kessels oder einer
Abdampfungspfanne; m, n, o sind hohle oben und unten
offene Kegel, wovon n einen Durchschnitt darstellt.
Diese auf geeigneten Füßen ruhenden Kegel sind dicht über der Oberfläche des Kessels
oder der Pfanne befestigt, so daß die Flüssigkeit einen freien Durchzug durch
dieselben hat. Sie haben den Zweck, auf- und niedersteigende Strömungen in
der zu erwärmenden Flüssigkeit zu erzeugen, und dadurch die Dampfbläschen im Momente
ihrer Entstehung von der Heizfläche wegzuführen, somit die Verdampfung zu
beschleunigen und das Eisen gegen das Verbrennen zu schützen. Wenn nämlich der Boden
der Pfanne erwärmt wird, so dehnt die Wärme die Flüssigkeit in den Kegeln aus und
erzeugt aufsteigende Strömungen, während die kühlere Flüssigkeit an der äußeren
Seite der Kegel herabsinkt, um die aufgestiegene Flüssigkeit zu ersetzen. Auf diese
Weise wird eine rasche und anhaltende Circulation und eine schnelle Verbreitung der Wärme erzielt.
Tafeln