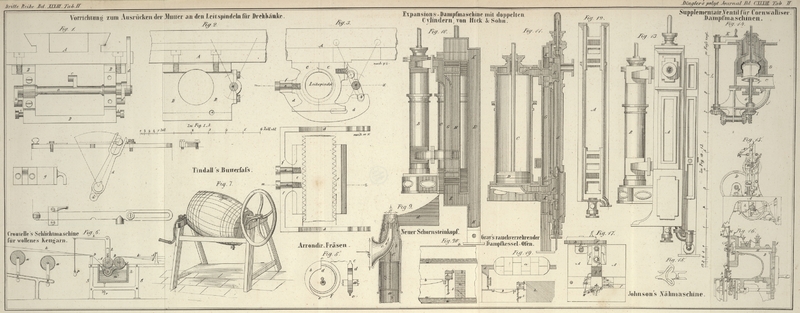| Titel: | Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen, welchen sich John Gray, Ingenieur zu Rotherhithe, am 1. August 1853 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. XXVII., S. 99 |
| Download: | XML |
XXVII.
Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen,
welchen sich John Gray,
Ingenieur zu Rotherhithe, am 1. August 1853
patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, April 1854, S.
250.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Gray's rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen.
Fig. 19
stellt diesen Dampfkessel-Ofen im Längendurchschnitte dar. a ist der Kessel; b der
Rost; c die Brücke; d das
Gemäuer, in welches der Kessel eingesetzt ist.
Die Brücke c besteht aus feuerfesten Ziegeln und ruht auf
einer gußeisernen Platte e, unter welcher eine
senkrechte Platte f angeordnet ist; letztere ist mit
einer Klappe g versehen. h
ist ein massives Mauerwerk, i eine Reihe von Oeffnungen
zwischen demselben und der Brücke c. k, k sind andere
Oeffnungen, welche durch die Brücke in den Ofen führen. Die Oeffnungen i und k stehen mit der
Kammer l in Verbindung, in welche durch die Klappe g Luft tritt. Wenn nun auf dem Roste b ein Kohlenfeuer brennt, so strömt ein Theil der
Verbrennungsproducte über die Brücke, während ein anderer Theil seinen Weg durch die
Oeffnungen k, k nimmt und einem durch die Klappe g eintretenden Luftstrom begegnet. Das heiße Gemenge strömt nun
durch den Einschnitt oder die Oeffnungen i und trifft
mit dem ersten über die Brücke streichenden Theil der Verbrennungsproducte zusammen.
Auf diese Weise werden die nicht verbrannten Gase entzündet und die Verbrennung geht
vollkommener vor sich, als wenn durch den Einschnitt i
nur kalte Luft zugelassen würde, wie dieses bei einigen rauchverzehrenden Oefen
seither der Fall war. Oeffnet man die Klappe g
vollständig, so tritt ein Theil der Luft durch die Oeffnungen k in den Ofen und der Rest durch die Oeffnungen i. In diesem Falle ist es vortheilhaft, das Brennmaterial anzuhäufen, so
daß es die Oeffnungen k theilweise oder sogar ganz
bedeckt. Dadurch wird eine lebhafte Verbrennung dicht an der Brücke hervorgebracht,
die also eine hohe Temperatur erlangt. Die übrigen noch nicht verbrannten Gase
kommen auf ihrem Weg über die Brücke mit der durch die Oeffnungen i herbeiströmenden Luft in Berührung und verbrennen
dadurch.
Fig. 20
stellt den Apparat ohne Klappe in Anwendung auf eine Dampfkesselfeuerung dar. a ist die äußere Kesselwand; m der Feuercanal, in welchem der Rost b, die
Brücke c und der Wall h
angeordnet sind. e ist die Platte, welche die Brücke
trägt, f die verticale Platte unterhalb derselben; diese
Platte reicht nicht bis an den Boden des Canals m, damit
eine Oeffnung g für den Zutritt der Luft entstehe. Die
übrigen Theile stimmen mit Fig. 19 überein. Die
Enden des Rostes b treten unter die Platte e, eine Anordnung, welche sich in denjenigen Fällen als
vortheilhaft erweist, wo die Roststäbe eine hin- und hergehende Endbewegung
haben.
Tafeln