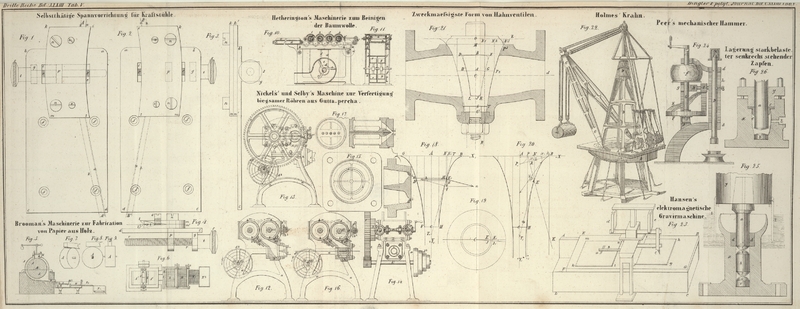| Titel: | Beschreibung einer neuen selbsthätigen Spannvorrichtung (Tempel) für Kraftstühle und für die mit einem Regulator versehenen Handwebstühle; von Karl Karmarsch. |
| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. LXXXI., S. 346 |
| Download: | XML |
LXXXI.
Beschreibung einer neuen selbsthätigen
Spannvorrichtung (Tempel) für Kraftstühle und für die mit einem Regulator versehenen
Handwebstühle; von Karl
Karmarsch.
Aus den Mittheilungen des hannover'schen Gewerbevereins,
1854, H. 2.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Selbstthätige Spannvorrichtung für Kraftstühle.
Die durch Elementarkraft getriebenen Webstühle sind gegenwärtig allgemein mit einem
selbsthätigen Spannapparate (selfacting temple) versehen, welcher die Stelle des sonst üblichen
Spannstocks (der Sperr-Ruthe) vertritt und vor diesem den wesentlichen Vorzug
hat, daß kein Fortrücken oder Weitersetzen nöthig ist. Handstühle gestatten die
Anbringung solcher Vorrichtungen nur in dem Falle, wo sie mit einem Regulator
versehen sind, welcher
das Gewebe nach Maaßgabe seiner Entstehung stetig und ohne Zuthun des Arbeiters
aufbäumt. Die neuerlich wohl am meisten angewendete, mit allerlei Modificationen des
Details vorkommende Art des selbstthätigen Spannapparats ist folgende: Zu jeder
Seite des Gewebes vorderhalb der Lade befindet sich eine messingene Scheibe von etwa
1 1/2 Zoll Durchmesser, deren Rand nach Art eines Spornrädchens ringsum mit kurzen
scharfen, in das Sahlband einstechenden Spitzen besetzt ist. Diese zwei in
unwandelbarem Abstande von einander befindlichen Scheiben gestatten das
Fortschreiten des zwischen ihnen liegenden Gewebes, ohne jemals in dessen Anspannung
nachzulassen, weil sie bei ihrer von selbst entstehenden langsamen Umdrehung stets
mit neuen Spitzen zum Eingriff kommen, also die Leiste des Stoffes nicht fahren
lassen. Sie sind jedoch mit dem Fehler behaftet, welcher auch dem alten Spannstocke
der Handweber vorzuwerfen ist: daß sie das Sahlband auf sehr unangenehme Weise
durchstechen und hierdurch öfters wesentlich beschädigen.
In neuester Zeit hat man eine Spannvorrichtung erfunden, welche von der eben
angezeigten gänzlich abweicht, sich durch Einfachheit wie durch sichere Wirkung
auszeichnet, und die Sahlbänder auf das Vollkommenste schont, da sie weder Löcher
hineinsticht, noch dieselben mittelst eines zangenartigen Apparats einklemmt.
In schweizerischen Fabriken wird diese Vorrichtung beim Weben der Musseline und
anderer Baumwollenzeuge mit entschiedenem Vortheile gebraucht. Die Zeichnungen auf
Tafel V sind in wirklicher Größe nach einem Exemplare
angefertigt, welches ich durch Hrn. Regierungsrath v. Steinbeis zu Stuttgart auf kurze Zeit zur Ansicht erhalten hatte.
Fig. 1 zeigt
die obere Ansicht des Apparates, wie er an der linken
Seite des Gewebes angebracht ist; Fig. 2 die obere Ansicht
des an der rechten Seite befindlichen Apparates. Beide
stimmen, die verschiedene Lage einiger Theile abgerechnet, so völlig mit einander
überein, daß dieselbe Beschreibung auf diesen wie auf jenen paßt. Deßhalb schien es
auch genügend, nur von einem (dem in Fig. 2 dargestellten) noch
andere Ansichten beizufügen, nämlich Fig. 3 die Seitenansicht
und Fig. 4 die
von vorn, d.h. vom Brustbaume aus, genommene Endansicht.
Die viereckige Eisenblechplatte a, b, c, d enthält vier
versenkte Löcher f, f, f, f mittelst welcher sie in
horizontaler Lage am Stuhlgestelle (zwischen Brustbaum und Lade, jedoch so nahe an
dieser letztern, als deren Vorwärtsbewegung beim Anschlagen gestattet)
festgeschraubt wird. Man bemerkt an derselben ferner noch die rechteckige Oeffnung
e, e und den von der untern Fläche vorspringenden
eingenieteten Lappen g, worin ein glattes rundes
Loch.
Der zweite Haupttheil besteht aus einem Paar Messingplatten von bogenförmiger
Gestalt, welche einander vollständig decken, so daß man in Fig. 1 und 2 nur die obere i, k, l, m sehen kann, wogegen bei k', m' in Fig. 3 und l' m' in Fig. 4 die untere
ebenfalls sich zeigt. Die concave Seite i, l dieser
Doppelplatte ist der Kante des Gewebes zugewendet. Zwei eiserne Schrauben n, n verbinden die obere und die untere Platte fest mit
einander; zwei kleinere dergleichen, o, o gehen nur
durch Gewindelöcher der obern Platte und stützen sich auf die Innenfläche der
untern, so daß sie die Platten vermöge deren Biegsamkeit und Federkraft ein wenig
von einander entfernen oder wieder einander nähern, je nachdem man o, o in geringem Maaße tiefer einschraubt oder nach oben
zurückzieht. In die Unterplatte k', l', m' ist ein
eiserner Lappen p eingenietet, welcher ein Loch mit
Schraubengewinden enthält; hierzu paßt das Gewinde der eisernen Schraube r, r, welche 24 Gänge auf 1 Zoll Länge zählt und mit
ihrem Kopfe t, s aus dem Ganzen geschmiedet ist. Wenn
die Doppelplatte auf das Blech a, b, c, d gelegt wird,
so tritt ihr Lappen p durch eine Oeffnung e, e, das Loch desselben steht jenem des Lappens g gegenüber, und durch diese beiden Löcher wird die
Schraube r eingeführt, welche mit t den unbeweglichen Lappen g berührt. Hiernach
ist ohne Weiteres ersichtlich, daß man durch Umdrehen der Schraube die Stellung der
messingenen Doppelplatte verändern und genau nach der Breite des Gewebes reguliren
kann.
Zunächst verdient die noch nicht völlig erklärte Beschaffenheit der messingenen
Doppelplatte Aufmerksamkeit, s. Fig. 4. Jede der Platten
l, m und l', m' ist auf
der innern Fläche und in der Nähe des concav gekrümmten Randes i, I so ausgefurcht, daß eine etwas geräumige Höhlung
u, z entsteht, welche durch den schmalen Spalt
zwischen l und l' nach außen
hin sich öffnet. Eben dieser Spalt nun wird vermöge der Adjustirung der Schrauben
o erweitert oder verengert und muß jederzeit der
Dicke des Gewebes so angepaßt seyn, daß letzteres darin weder eingeklemmt wird noch
merklichen Spielraum hat. In der Kante oder Leiste ist ein einzelner dicker Faden
mit geschert, und dieser kommt dicht hinter den Spalt zu liegen, wie man ihn bei u angezeigt findet, während in dem hohlen Raume die
Leiste u, z von dem dicken Faden u bis an den äußersten Rand z bequem Platz
findet. Man wird dieß leichter verstehen, wenn man einen Blick auf Fig. 1 und 2 wirft, wo die einfache
punktirte Linie zz den Rand des Stoffes, die
doppelte uu aber den dicken Kettenfaden bedeutet. Letzterer
empfängt vermöge der Querspannung des Gewebes ein Bestreben, durch den Spalt der
Doppelplatte herauszuschlüpfen, kann aber dieß nicht thun, weil für ihn der Spalt zu
eng ist. Daher hält die gedachte Spannung stets in gleichem Maaße an, und
demungeachtet kann das mittelst des Regulators vom Brustbaume oder Zeugbaume stetig
angezogene Gewebe ohne Hinderniß in seiner Längenrichtung – von A, B nach A', B'
fortschreiten.
Es ergibt sich aus dem Gesagten von selbst, daß die Platte i,
k, I, m oberhalb, dagegen k', l', m' und a, b, c, d unterhalb des Gewebes liegt.
Tafeln