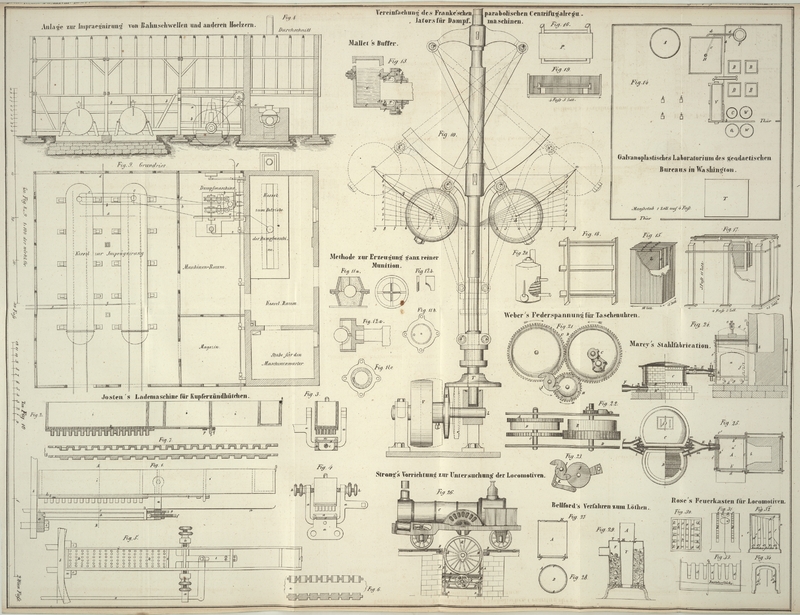| Titel: | Vereinfachung des Franke'schen parabolischen Centrifugalregulators für Dampfmaschinen. |
| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. LXXIX., S. 322 |
| Download: | XML |
LXXIX.
Vereinfachung des Franke'schen parabolischen Centrifugalregulators für
Dampfmaschinen.
Mit einer Abbildung auf Tab. V.
Vereinfachung des Franke'schen Centrifugalregulators für
Dampfmaschinen.
Der empfindlichste und beste Regulator für Dampfmaschinen ist bekanntlich der von Franke erfundene (beschrieben im polytechn. Journal Bd. CVIII S. 321), wobei die Schwungkugeln
gezwungen sind, nach einer Parabel aufzusteigen, was dadurch erreicht wird, daß die
Kugeln mittelst Gabelstücken jede an einer kleinen Rolle hängen, welche Rollen auf
einer parabelähnlichen Curve laufen, die mit der durch den Schwerpunkt der Kugeln
gezogen gedachten eigentlichen Parabel correspondirt.
Der Grund warum dieser Regulator noch nicht häufiger in Anwendung gekommen ist, mag
wohl darin liegen, daß dessen Ausführung, wenn er richtig wirken soll, mehr
Aufmerksamkeit erfordert, als bei dem gewöhnlichen Watt'schen.
Fig. 10
stellt nun einen neuen Regulator dar, der die Theorie des Franke'schen Regulators mit der Einfachheit der Ausführung des Watt'schen vereinigt.
Es seyen mB und An Theile der nach der Umdrehungszahl des Regulators berechneten Parabel,
B und A die tiefste, m und n die höchste Stellung
der Kugeln. Nun halbire man den Parabelast mB in
q, so läßt sich durch die drei Punkte mqB ein Kreisbogen beschreiben, dessen Mittelpunkt
auf die entgegengesetzte Seite der stehenden Welle S,
nämlich nach b fallen wird. Wendet man dasselbe
Verfahren für den Parabelast An an, so wird für
Bogen Arn der Mittelpunkt nach a fallen.
Ueberzeugt man sich durch Verzeichnung in Naturgröße, so wird man finden, daß die
Kreisbogen sehr wenig von der Parabel abweichen, fast weniger als man beim Ausfeilen
einer Curve fehlen kann. Man hat somit gewissermaßen wieder einen Watt'schen Regulator, nur ist die Lage der Pendeldrehungspunkte a und b und sind die
Pendellängen aA und bB genau bedingt. Es ist daher nöthig, die Welle S auf ein kurzes Stück zu schlitzen, um die sich kreuzenden Arme aA und bB
durchzulassen.
Der Parameter der Parabel ist aber nach Franke gleich der
doppelten Endgeschwindigkeit, welche ein freifallender Körper in der ersten Secunde
erlangt, dividirt durch das Quadrat der zu erhaltenden normalen
Winkelgeschwindigkeit der Kugeln. Setzen wir den Parameter = p, so hat man p = 2g
/v² ferner sey n
die für den Regulator festgesetzte Umdrehungszahl in der Minute, so ist v = 2nπ
/60, woraus man dann erhält:
p = (5653 . 839)/n² in Wiener Fußen, oder
p = (1788 . 8)/n² in Metern.
Läßt man die Mittelpunkte der Kugeln bis auf 1 1/8, d. i. 1,125 p auseinandergehen, wie dieses in m und n der Fall ist, so dürfte sich so
ziemlich die gefälligste Form herausstellen, und wenn man nachfolgende Regel
beobachtet, so kann man sich auch das Verzeichnen der Parabel ersparen und hat unter
obiger Bedingung für die Entfernung der Mittelpunkte ab von einander, ab = 1/2 p; Entfernung mn =
1,125 p; die Pendellängen aA und bB genau = 1,062 p. Die Kugeln, welche nicht kleiner als 0,29 p seyn sollten, rathet man, um sie recht schwer zu
bekommen, mit Blei voll zu gießen.
In Wien, woher auch dieser neue Regulator stammt, wurden bereits. vier Stück
desselben ausgeführt, welche mit größter Empfindlichkeit arbeiten, daher die
allgemeine Anwendung desselben bestens empfohlen werden kann.
Bei dieser Gelegenheit sey noch der Bewegungs-Uebertragung von der liegenden
Welle L auf den Regulator Erwähnung gethan, welche dort
sehr anwendbar ist, wo man die Normalgeschwindigkeit der Maschine zeitweise ändern
muß.
Die Scheibe T an der feststehenden Welle ist unten ganz
flach, und ruht durch das Gewicht des Regulators auf der schmalen Scheibe K der liegenden Welle, da der untere Zapfen der
stehenden Welle nicht auf dem Grund seines Lagers aufsitzt, somit die Scheibe K die Scheibe T
durch Adhäsion in
Bewegung bringt. Die Scheibe K, welche mit einer
Riemenscheibe V in Verbindung ist, läßt sich auf der
Welle L verstellen, um einen Unterschied in der
Uebersetzung der Bewegung, somit, wie oben erwähnt, eine Aenderung der
Normalgeschwindigkeit der Maschine auf einfache Weise zu ermöglichen.
Wien, im April 1855.
A. D.
Tafeln