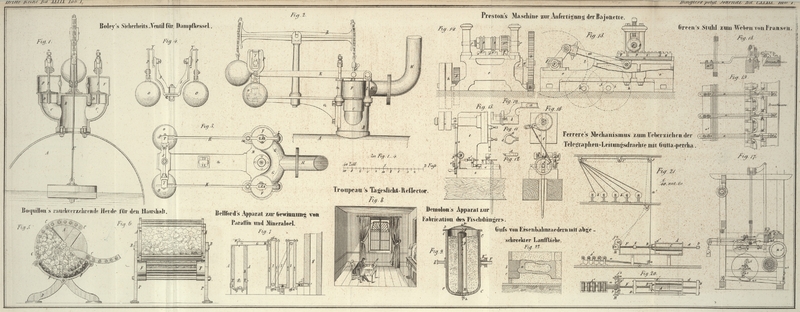| Titel: | Verbesserungen an Bajonetten und an den Maschinen zur Anfertigung derselben, welche sich Francis Preston zu Manchester, am 30. December 1854 patentiren ließ. |
| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. IV., S. 8 |
| Download: | XML |
IV.
Verbesserungen an Bajonetten und an den Maschinen
zur Anfertigung derselben, welche sich Francis Preston zu Manchester, am 30. December 1854 patentiren ließ.
Aus dem London Journal of arts, Sept 1855, S.
153.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Preston's Verbesserungen an Bajonetten.
Diese Verbesserungen bestehen 1) in der Anfertigung des zum Bajonettschluß gehörigen
Aufhälters aus einem Stücke mit der Hülse, anstatt
denselben, wie seither, an die Hülse zu schweißen oder zu schrauben; 2) in der
Anfertigung des Schlußringes aus Gußstahl; 3) in der Vermehrung der Dicke des
Schlußringes an derjenigen Stelle, wo seine Tiefe wegen des Aufhälters vermindert
wird.
Die Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung von Bajonetten bestehen in einer
zweckmäßigeren Verbindung derjenigen Theile, welche zur Herstellung und Vollendung
der Hohlkehlen der Bajonettklingen dienen; ferner in einer Vorrichtung zum
selbstthätigen Einstellen der Maschine, welche die Rinne in die Hülse des Bajonetts
schneidet; endlich in der Anbringung einer ähnlichen Vorrichtung an der Maschine welche die Bajonetthülsen
fertig macht.
Fig. 10
stellt ein gewöhnliches Bajonett dar. a ist die Klinge;
b die Hülse; c der
Aufhälter. Seither war es üblich, den letzteren an die Hülse zu schweißen oder zu
schrauben; da jedoch das die Hülse bildende Metall sehr dünn ist, so kann der auf
diese Weise befestigte Aufhälter durch die häufigen Manipulationen mit dem Bajonett
leicht lose werden und herausfallen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, macht der
Patentträger den Aufhälter mit der Hülse aus einem Stück
und läßt daher an der Hülse beim Abdrehen da, wo der Aufhälter hinkommen soll,
ringsherum eine Schulter; der größte Theil dieser Schulter wird dann entweder aus
freier Hand oder auf sonstige Weise abgeschnitten, so daß der hervorragende
Aufhälter übrig bleibt.
Fig. 11
stellt den verbesserten Schlußring, durch welchen das Bajonett an der Mündung des
Gewehrs festgehalten wird, im Grundriß, Fig. 12 im Durchschnitt
dar. In Fig.
11 bemerkt man, daß derjenige Theil des Schlußringes zwischen den
Schultern d, d, welcher gegen den Aufhälter c in Fig. 10 zu liegen kommt,
dicker ist, um die Verminderung in seiner Tiefe auszugleichen. In Folge dieser
Einrichtung ist der Schlußring dem Zerbrechen beim Aufstecken und Abnehmen des
Bajonetts nicht so leicht ausgesetzt, als bei der gewöhnlichen Construction. Auch
sind diese Schlußringe nicht, wie gewöhnlich, aus Schmiedeisen oder Messingguß,
sondern aus Gußstahl, welcher einen höheren Grad von Elasticität, als diese Metalle
besitzt.
Fig. 13
stellt die verbesserte Maschine zum Vollenden der Hohlkehlen der Bajonettklingen in
der Seitenansicht, und Fig. 14 in der Endansicht
dar. e ist eine starke gußeiserne Fundamentplatte, an
welcher die Lager f zur Aufnahme der Kurbelwelle g befestigt sind. Diese Welle wird von der Treibrolle
h aus in eine langsame Rotation versetzt, indem das
Getriebe i in das Rad j und
das an der Achse des letzteren sitzende Getriebe k in
das Rad l greift, welches an die Kurbelwelle befestigt
ist. Die Verbindungsstange m ist an dem einen Ende in
die Kurbel eingehängt, an dem andern Ende mit der unteren Seite der Tafel n verbunden, welche in Nuthen der Platte e verschiebbar ist. An die Tafel n sind zwei oder mehrere Blöcke o und die
Formen p, ferner die Zugstange q befestigt. Letztere greift in ein Getriebe r¹, welches an die Welle r befestigt ist,
deren Lager an die Fundamentplatte e geschraubt sind.
s sind stählerne Walzen, deren Rinnen, dem Bajonett
und seiner Hohlkehle entsprechend, verjüngt zulaufen und am Boden convex sind. Auch
die Formen p haben eine verjüngt zulaufende Rinne mit einer den Hohlkehlen
an der äußeren Seite des Bajonettes entsprechenden doppelten Convexität.
Die Operation mit der Maschine ist nun folgende. Das auf geeignete Weise zurecht
geschmiedete Bajonett wird glühend gemacht und auf eine der Formen p gelegt; hierauf wird die Kurbelwelle, der Schieber n und die Welle r in
Thätigkeit gesetzt. Dadurch wird das Bajonett in die Rinne der Form p gepreßt. Jede halbe Umdrehung der Kurbelwelle g bildet die Hohlkehlen eines Bajonetts. Die Rinne der
Walze s greift über den oberen Rand der Form p, um jedes aus der Form herausragende überflüssige
Metall abzuschneiden. Sobald ein Bajonett auf diese Weise bearbeitet worden ist,
wird es aus der Maschine genommen, und ein anderes in die zweite Form gelegt, um
während der zweiten Hälfte der Rotation der Kurbelwelle die gleiche Behandlung zu
erfahren.
Fig. 15
stellt eine kleine Schlitzmaschine gewöhnlicher Construction, an welcher die in Rede
stehenden Verbesserungen angebracht sind, in der Seitenansicht, Fig. 16 in der hinteren
Ansicht dar. t ist das Hauptgestell; u das Schneidinstrument, welches durch ein an der Welle
u¹ sitzendes Excentricum in auf- und
nieder gehende Bewegung gesetzt wird; v der Schieber,
von welchem ein Zapfen v¹ hervorragt, der die
Hülse des Bajonetts aufnehmen soll. Dieser Schieber erhält vermittelst der Schraube
v², des Sperrrades v³ und des Sperrkegels v⁴ eine
Bewegung, vermöge welcher er die Hülse dem Schneidinstrument u entgegenführt. Die Verbesserungen selbst bestehen in dem Verfahren, die
Bewegung des Schiebers v einzustellen, wenn der Schlitz
in der Bajonetthülse die erforderliche Tiefe erlangt hat. An den Schieber v ist eine Hervorragung w
befestigt, deren oberes Ende eine Regulirungsschraube w¹ enthält, welche auf die Feder x wirkt,
wenn der Schieber bis zum gehörigen Punkt vorgerückt ist. Diese Feder tritt in einen
Einschnitt der Schiebstange y, welche in ein Loch des
Gestells t paßt. Die Stange y enthält eine Hervorragung y¹, mit
einer Stellschraube y³. Auf diese Stange wirkt
die Feder y². Wenn nun die Schraube w die Feder x aus dem
Einschnitt der Stange y herausschiebt, so schiebt die
Feder y² die Stange y
so weit, daß der Kopf der Stellschraube y³ den
Sperrkegel v⁴ aus dem Sperrrad v³ hebt, und dadurch dem weiteren Vorrücken des
Schiebers v Einhalt thut. Der Maschinenwärter schiebt
sodann den Treibriemen von der festen auf die lose Rolle, um die Maschine in
Stillstand zu bringen, nimmt das Bajonett von dem Bolzen v¹ ab und steckt ein neues auf. Der Handgriff an dem Sperrrade v³ hat den Zweck, den Schieber zurückzuschrauben,
wenn ein neues Bajonett aufgesteckt werden soll.
Tafeln