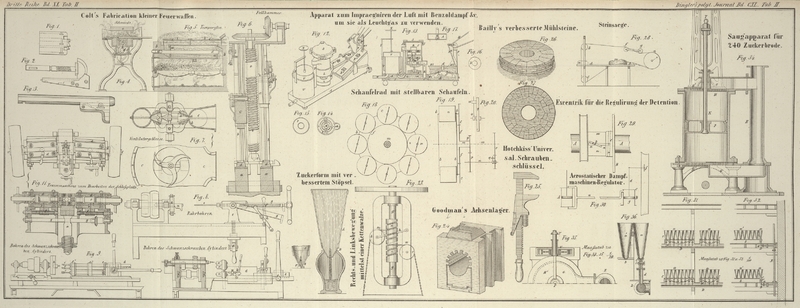| Titel: | Formen mit verbessertem Pfropf für Zuckerraffinerien; von J. Steele zu Greenock. |
| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. XX., S. 99 |
| Download: | XML |
XX.
Formen mit verbessertem Pfropf für
Zuckerraffinerien; von J.
Steele zu Greenock.
Aus dem Practical Mechanic's Journal, Januar 1856, S.
230.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Steele's Formen mit verbessertem Pfropf.
Wenn beim Russinnen des Zuckers das Abfließenlassen des grünen Syrups von den Broden
nach meinem Verfahren ausgeführt werden soll, so steckt man die Stöpsel in die Formen, bevor die
flüssige Zuckermasse in dieselben eingegossen wird. Diese Stöpsel haben breite Köpfe
oder Flanschen, welche mit Scheiben von Tuch oder einem elastischen Stoffe versehen
sind, um die Oeffnung der Form dicht zu verschließen. Dadurch wird jeder Verlust
vermieden.
Soll das Ablaufen des Syrups beginnen, so wird der Stöpsel aus der Form gezogen und
hinterläßt in dem Zuckerhut die durch ihn gebildete Abtropfe-Oeffnung.
Dadurch wird der Proceß nicht allein wesentlich verkürzt und vereinfacht, sondern
die Wirkung ist auch bei sämmtlichen Broden ganz gleichartig. Fig. 21 ist ein
senkrechter Durchschnitt der Spitze einer Zuckerform, in deren Oeffnung der
verbesserte Stöpsel steckt, so daß die Form die flüssige Zuckermasse aufnehmen kann.
Fig. 22
ist ein senkrechter Durchschnitt der mit Zucker angefüllten Form mit dem Topf, in
welchen die Flüssigkeit abtröpfelt. Die Form A, in
welche der Zucker gegossen wird, hat die gewöhnliche conische Gestalt, besteht aus
dünnem Metallblech und ist an der Spitze B mit der
erforderlichen Oeffnung versehen; der Stöpsel C, womit
letztere verschlossen wird, hat, wie Fig. 21 zeigt, eine
Spitze D, welche in die Form hinaufreicht; eine Scheibe
E von Leder oder einem andern passenden Material,
ist über die Spitze geschoben und liegt auf dem Kopfe auf, um mit dem Stöpsel die
Formöffnung so dicht als möglich verschließen zu können. Nachdem der Stöpsel in die
Form gesteckt worden ist, wird die Flüssigkeit auf gewöhnliche Weise in dieselbe
eingegossen; ist dann die Zuckermasse hinlänglich fest geworden, so wird der
Verschluß herausgezogen und es bleibt die Vertiefung F
in dem Zucker zurück, wie Fig. 22 zeigt. Es ist
einleuchtend, daß das hier beschriebene Verfahren, wodurch in allen Zuckerbroden
eine Vertiefung von gleicher Größe und Lage gebildet wird, diesen Theil des
Raffinirens weit sicherer und regelmäßiger machen muß, als die gewöhnliche
Herstellung der Vertiefung durch die Hand und ein Werkzeug, nachdem die Masse vorher
fest geworden ist. (Patentirt in England am 11. Mai 1855.)
Tafeln