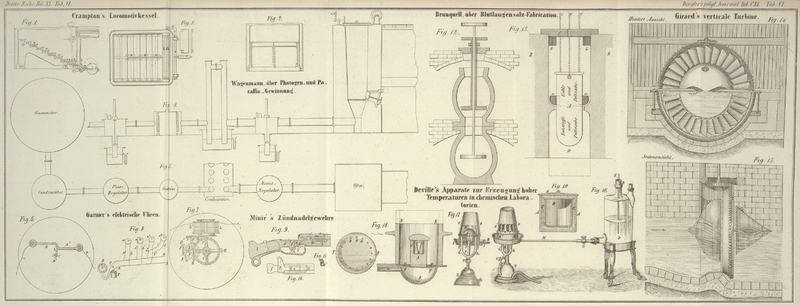| Titel: | Ueber Photogen- und Paraffin-Gewinnung; von P. Wagenmann, Ingenieur in Bonn. |
| Autor: | Paul Wagenmann |
| Fundstelle: | Band 140, Jahrgang 1856, Nr. CIV., S. 461 |
| Download: | XML |
CIV.
Ueber Photogen- und
Paraffin-Gewinnung; von P.
Wagenmann, Ingenieur in Bonn.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Wagenmann, über Photogen- und
Paraffin-Gewinnung.
Nachdem ich in meinen früheren Berichten mich speciell mit der Verarbeitung des rohen
Theers befaßt habe, komme ich jetzt auf die Gewinnung des Theers aus Braunkohle,
Torf, Schiefer, Cannelkohle und bituminösem Thon zurück.
Diese verschiedenen Rohmaterialien bedingen selbstredend verschiedene Methoden der
Destillation, selbst eine und dieselbe Art muß oft, je nach ihren verschiedenen
Eigenschaften und den bestehenden localen Verhältnissen, mittelst verschiedener
Apparate verarbeitet werden. So ist es nothwendig, staubige und erdige Braunkohlen
anders zu verarbeiten als stückige; ferner bedingt auch der beabsichtigte Zweck in
den Fällen, wo das Rohmaterial verschiedene Producte daraus darzustellen gestattet,
das Einschlagen verschiedener Destillationsmethoden; man kann z.B. bei Verarbeitung
von Braunkohlen die Absicht haben mehr Kohks zu gewinnen als Theer, oder umgekehrt
mehr Theer. Ueberdieß kommt auch viel auf die Lage des verfügbaren Rohmaterials und
die Absatzwege für die Fabricate an. Ich halte für die Braunkohle, sobald dieselbe
in Stücken vorkommt, und eine entsprechende Verwerthung der Producte als künstliche
Kohle (Patent Fuel) vorhanden ist, den Weg für den
besten, wo neben viel Kohks ein großer Theil des Theers gewonnen wird, mithin die
Verkohlung in Schacht-Oefen. In diesem Sinne
sprach ich mich schon im J. 1847 in England aus, als die irländische Torfcompagnie
ihre ersten Versuche mit Retorten gemacht hatte, um aus dem Torfe Kohks nebst
Paraffinöl zu gewinnen; denn was für Braunkohle gilt, ist in den meisten Fällen auch
für den Torf geltend, insbesondere für die ausgezeichneten Qualitäten der Bogs in
Irland, sowie des Dartmoore in England. Bei dem Torf ist die Ausbeute an Theer so
gering, daß seine Verarbeitung auf diesen allein sich nicht lohnen dürfte, wenn
nicht eine entsprechende Verwerthung der Kohks vorhanden. Diese Fabrication der
Torfkohks ist durch die Verbesserungen verschiedener Ingenieure, als Gwynne, Warlich etc., so vervollkommnet worden, daß
dieses Brennmaterial jedes andere an Wirkung übertrifft, worüber ich mich auf die
Berichte des Hrn. W. Fairbairn
beziehe.
Man ist in neuer Zeit auch in Irland auf die Destillation des Torfes in Schachtöfen
übergegangen; dieselben sind im Allgemeinen nach dem Princip des Bellford'schen PatentsPolytechn. Journal Bd. CXXXIX S.
42. construirt, haben aber den Uebelstand, daß der Theer theilweise verloren
geht, indem die Oefen unten angebrannt werden und die Dämpfe oben abziehen lassen.
Der Theer condensirt sich in den oberen kalten Theilen, was nach längerer Zeit ein
Herabtraufen desselben in die brennende Masse zur Folge hat, daher diese
fortwährende Umdestillirung eines Theils des Theers viel Verlust veranlaßt. Schon im
J. 1847 nahm ich Gelegenheit mich über dieses Verfahren gegen Hrn. Statham in Hull auszusprechen, und
im J. 1853 brachte ich in einer Gesellschaft von Ingenieuren in London meine Ansicht
über diesen Gegenstand wieder zur Sprache; ich empfahl nämlich die Destillation von
Oben nach Unten zu leiten, so daß das Material oben angebrannt und die
Destillationsproducte von Unten mittelst Pumpen abgezogen werden, mithin die
theerigen Theile nie zur Flamme zurücktreten können. Hr. P. Sanders, Ingenieur, und Dr. Price vom College of
Chemistry interessirten sich dafür und besprachen die Sache mit mir noch speciell,
so daß ich mich veranlaßt fand Versuche anzustellen, welche mich überzeugten, daß
dieses System für Braunkohlen und Torf auszuführen ist, insbesondere wenn die Materialien vorher mittelst
Schneide- und Preßmaschinen verarbeitet wurden.
Für Schiefer- und Boghead-Kohlen ist dieses System aber nicht zu
empfehlen, weil bei denselben die Ausbeute an Theer zu groß und diejenige an
überschüssiger Kohle zu gering ist, und bei dem starken Zug, welchen man zur
Verbrennung anwenden muß, die Destillation so schnell erfolgt, daß zuletzt in Folge
der zu großen Hitze von den flüchtigen Producten zuviel verbrennt, folglich nur ein
schlechter schwerer Theer erhalten wird. Materialien welche sonst einen Theer von
0,880 spec. Gewicht gaben, lieferten auf diese Weise einen solchen von 0,930 und
darüber. Da die leichten Oele mithin zerstört werden, so ist dieses System für die
genannten Kohlen nicht anwendbar.
Braunkohle und Torf hingegen, welche schwerere Theere erzeugen, auch bei schwachem
Zuge leicht brennen, dabei 40 bis 50 Proc. Kohle zurücklassen, eignen sich für jenes
Destillationssystem besser.
Folgendes ist die Beschreibung eines derartigen Apparats,
Fig. 4 und
5, den ich
jetzt in Oesterreich ausführen zu lassen beabsichtige. Der Ofen bekommt eine
Schachthöhe von 20 Fuß bei 5' oberem und 4' unterem Durchmesser. Diese Differenzen
der Durchmesser ändern sich bei verschiedenem Material, indem die Verjüngung das Schwinden
des Materials während der Destillation ausgleichen muß. Am untern Theile schließt
sich ein kegelförmiges Mundstück an, welches auf 2 Fuß ausgeht und sich in ein Rohr
von gleichem Durchmesser verlängert. Die Tiefe des Kegels ist 5 Fuß. Zwischen dem
Kegel und Schacht befindet sich ein Rost, über welchen das Material geschichtet ist.
Der untere Kegel bleibt mithin frei und dient eigentlich als Luftkasten, um die
Differenz der ausströmenden Gase auszugleichen. Ueber dem Rost befindet sich ein
Mannloch zum Ausnehmen des verkohlten Materials. Am obern Theile des Schachtes
befindet sich eine Bühne und ein Aufzug für die Beschickung, ferner ein Deckel mit
zölligen Löchern versehen, die sich durch eine aufliegende Platte mittelst eines
Hebels beliebig kleiner und größer stellen lassen. Am untern Kegel setzt sich ein
Windrohr von 20 Fuß Durchmesser an; dasselbe führt in einen Regulator, den ich
Minus-Regulator nennen will. Dieser ist ein verschlossener Kasten von 6 Fuß
Durchmesser, 4 Fuß Höhe, auf welchem sich ein Dom befindet; in letzterm ist ein
Loch, welches durch einen Conus verschlossen ist, der an seiner Verlängerung eine
Schwimmkugel trägt, die in einer pneumatisch verschlossenen Röhre schwimmt. Am
Kasten sind außerdem Thermometer und Barometer angebracht. Sobald die Pumpen zu
stark saugen, hebt sich die Flüssigkeit in der Röhre, mithin auch die Kugel und der
Conus, und es strömt direct Luft aus dem Gasometer in den Regulator, daher das
Barometer auf seinen normalen Standpunkt zurückgeht.
Vom Minus-Regulator strömen die Gase durch eine trockene Condensation, aus 24
Stück 20 Fuß hoher Röhren von 10 Zoll Durchmesser bestehend; dieselben sind unten im
Theerbehälter durch den Theer selbst pneumatisch geschlossen. Von da gelangen die
Gase in die Gebläse-Maschine von 30 Zoll Durchmesser, 36 Zoll Hub und 32
Umdrehungen. Nach dem Auswerfen aus dem Gebläse-Cylinder gelangen die Gase in
den Plus-Regulator, welcher wie der erstere construirt ist, nur daß hier der
Conus umgekehrt sitzt und durch Zunehmen des Drucks, resp. Fallen der Kugel,
geöffnet wird; schließlich gelangen die Gase in den Gasometer, wo sie ihre letzten
Theertheile absetzen.
Die Manipulation ist sehr einfach. Der Ofen, nachdem er gefüllt ist, wird durch eine
brennende 6 Zoll hohe, gleichmäßig vertheilte Kohlenschichte in Brand gesteckt und
das Gebläse in Gang gesetzt. Man saugt im Anfange sehr langsam, um eine Trocknung
des angewandten Materials, resp. Verdampfung des darin enthaltenen Wassers zu
veranlassen; später, wenn das Wasser nachläßt und das Thermometer des
Minus-Regulators auf 70° C. gestiegen ist, läßt man die Pumpen stärker
gehen. Man kann
annehmen, daß zur Trocknung 12 Stunden und zur Destillation 36 Stunden nothwendig
sind. Bei meinen Versuchen erhielt ich über die Hälfte des Theers, welchen die
trockne Destillation des Materials nachweist.
Die Kohks werden nachher am untern Ende ausgezogen und in eine dicht verschließbare
Löschgrube gebracht, aus welcher dieselben nach einigen Tagen genommen und auf ein
künstliches Brennmaterial (Patent Fuel oder Charbon de Paris) verarbeitet werden.
Der Vortheil dieser Oefen wird in der leichten Handhabung bestehen, um große Massen
verarbeiten zu können, und bei gut geleitetem Destillationsproceß werden sie gute
Kohks liefern, die allen Anforderungen entsprechen. Natürlich rathe ich bei Anlage
dieser Oefen äußerst vorsichtig zu seyn, da dieselben sich nur für bestimmte
Qualitäten von Rohmaterial eignen werden und eine sehr sorgfältige Construction in
ihren Details erfordern, welche nach den im Großen gemachten Erfahrungen abgeändert
und vervollkommnet werden müssen.
Bonn, im April 1856.
Tafeln