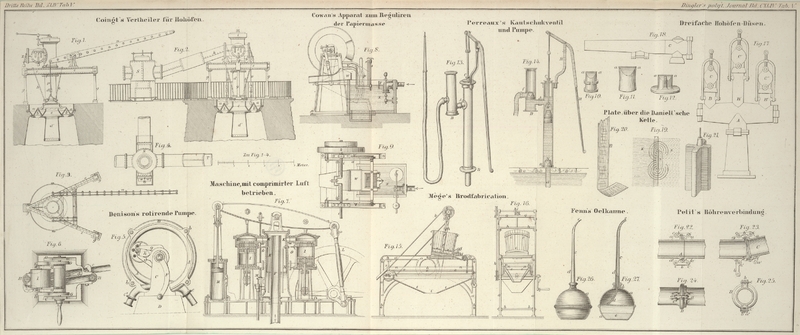| Titel: | Verbessertes Verfahren der Brodbereitung; von Hippolite Mège, Chemiker zu Paris. – Patentirt für England am 14. Juni 1856. |
| Fundstelle: | Band 144, Jahrgang 1857, Nr. XCIII., S. 373 |
| Download: | XML |
XCIII.
Verbessertes Verfahren der Brodbereitung; von
Hippolite Mège, Chemiker zu Paris. – Patentirt
für England am 14. Juni 1856.
Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Mai 1857,
S. 353.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Mège's verbessertes Verfahren der Brodbereitung.
Ich habe mich durch eine wissenschaftliche Untersuchung überzeugtMan vergleiche Chevreul's Bericht über diese
Arbeit, S. 209 in diesem Bande des polytechn.
Journals. A. d. Red. daß die Säuerlichkeit, der schlechte Geschmack und die bräunliche Farbe des
sogenannten Schwarzbrodes nicht vom Korn selbst herrühren, sondern die nothwendige
Folge des bisherigen Verfahrens bei der Brodbereitung sind; diese Fehler des Brodes
werden nämlich durch eigenthümliche, im Schwarzmehl enthaltene Fermente veranlaßt,
welche die milchsaure, essigsaure, ammoniakalische (faule) und ulminsaure Gährung
hervorrufen und dem Brod dadurch den schlechten Geschmack und die bräunliche Farbe
ertheilen.
Meine Erfindung besteht nun darin, weißes Brod, welches dem Brod erster Sorte
gleichkommt, mit Benutzung aller Bestandtheile sowohl des Weißmehls als des
Schwarzmehls (kleiehaltigen Mehls) von Weizen und Roggen darzustellen, oder Weißbrod
mit solchem Mehl, welches bisher nur Schwarzbrod liefern konnte, zu erzielen.
Erster Fall.
Wenn Mittelmehl benutzt wird. – Dieses Mehl ist
auf 73, oder 75 bis 80 Procent gebeutelt.Das heißt so, daß 100 Theile Weizen 73 bis 80 Theile Mehl zur Benutzung
gegeben haben. Indem man bei dieser Mehlsorte eine flüssige Hefe anwendet, welche die
Gährung zu beschleunigen und den sauren Geschmack des Brodes zu beseitigen vermag,
erhält man eine vollkommen weiße und angenehm schmeckende Brodsorte, was bisher ganz
unbekannt war.
Mein Verfahren ist folgendes: ich nehme einen Theil des Mittelmehls, z.B. den vierten
Theil, verdünne ihn mit der geeigneten Menge Wasser, und setze dieser mehligen
Flüssigkeit auf je 200 Theile Wasser 1 Theil Bierhefe zu, nebst so viel Säure (Weinsteinsäure),
so daß die Flüssigkeit das blaue Lackmuspapier schwach röthen kann. Wenn die
Flüssigkeit in voller Gährung ist, knete ich ihr die rückständigen Mehlportionen
bei, und lasse dann in gewöhnlicher Weise den Teig aufgehen.
Zweiter Fall.
Wenn Schwarzmehl angewendet wird.Der erwähnte Bericht von Chevreul ergänzt die
Beschreibung dieses Verfahrens in einigen Details. A. d. Red. – Unter Schwarzmehl verstehe ich das nur einmal durch die Steine
gegangene Korn, von welchem durch Beuteln 10 bis 15 Procent verschiedener Kleien
abgesondert worden sind. Dieses Weizenmehl ist stets mit Kleienrückständen gemischt,
und wird gewöhnlich nicht als solches in den Handel gebracht, sondern ein
zweites- und drittesmal gemahlen, um daraus sogenanntes weißes Mehl und Kleie
zu erhalten. Statt dieses Verfahrens trenne ich das Schwarzmehl durch bloßes Beuteln
– ohne wiederholtes Mahlen – in zwei Theile, nämlich in beiläufig 70
Theile weißes Mehl und 15 bis 18 Theile grobes oder schwarzes Grützenmehl.
Mit diesem Grützenmehl bereite ich das Ferment, indem ich es mit halb so viel Wasser
als das Gewicht des sämmtlichen Schwarzmehls betrug, zu einer teigigen Masse knete,
welcher ich Bierhefe und Weinsteinsäure beigebe. Dieses Gemisch lasse ich dann bei
einer Temperatur von 20° R. sechs Stunden lang (bei 16° R. zwölf
Stunden, bei 12° R. zwanzig Stunden) gähren. Während dieser geistigen Gährung
erleiden die verschiedenen Bestandtheile (Cerealin etc.) welche durch ihre
eigenthümliche Wirkung Schwarzbrod erzeugen, eine Veränderung; insbesondere verliert
der Kleber seine Häutchen und seinen Zusammenhang, und dasselbe Mehl welches nach
dem gewöhnlichen Verfahren nur ein Brod von dunkelbrauner Farbe geliefert haben
würde, gibt nun ein Brod bester Sorte, namentlich wenn man die gegohrene milchige
Flüssigkeit noch durch ein Sieb passirt, um die darin suspendirten Kleientheilchen
abzusondern.
Die durch das Sieb passirte Flüssigkeit ist weiß, und bildet das Ferment, welchem ich
die oben erwähnten 70 Theile weißes Mehl, die durch das Beuteln abgesondert wurden,
auf einmal oder in mehreren Operationen beiknete, um den Brodteig zu erhalten.
Dieser Teig geht sehr schnell auf und liefert ein ausgezeichnet schönes Brod. Man
erhält sogar noch ein genügend weißes Brod, wenn man das Absieben der Kleien
unterläßt.
Nach den gewöhnlichen Verfahrungsarten gewinnt man aus 100 Theilen Weizen 70 bis 75
Theile Mehl, welches Weißbrod von bester und mittlerer Sorte liefern kann; dagegen
erhält man nach meiner Methode von 100 Theilen Weizen 85 bis 88 Theile Mehl, welches
ein besonders schönes Weißbrod, von bestem Geschmack und vorzüglicher Nahrhaftigkeit
liefert.
Sollte man sich nicht leicht frische Bierhefe verschaffen können, so empfehle ich
dieselbe bei einer Temperatur von ungefähr 24° R. zu trocknen, nachdem man
sie mittelst irgend eines unwirksamen Pulvers gehörig vom Wasser abgesondert hat;
vor dem Gebrauch muß man sie in ihr zehnfaches Gewicht Wasser tauchen, welches durch
Zusatz von Stärkezucker schwach süß gemacht worden ist, und zwar acht bis zehn
Stunden lang, während welcher Zeit die Flüssigkeit in volle Gährung kommt, wornach
die Hefe ihre frühere Kraft wieder erlangt hat.
Mein Verfahren eignet sich auch zur Darstellung von Roggenbrod, wozu dem Roggenmehl
nur beiläufig 25 Procent grobe Kleien durch Beuteln entzogen werden.
Für Zwieback wende ich dieselbe Methode an, nur wird der Teig sehr fest gemacht und
unmittelbar in den Ofen eingeschossen; ich erhalte so einen viel schmackhafteren
Zwieback, als man bisher erzielte.
Apparate. Nachdem ich von dem einmal durch die Steine
gegangenen Weizen (Schwarzmehl) durch Beuteln beiläufig 70 Procent weißes Mehl
abgesondert habe, entziehe ich den rückständigen 30 Procent nur beiläufig 20 Procent
(schwarzes) Grützenmehl, indem ich die übrigen 10 Procent vernachlässige, nämlich in
ihrem Zustande verkaufe. – Die 20 Procent Grützenmehl werden in oben
angegebener Weise mit Wasser, welchem Bierhefe und etwas Weinsteinsäure beigegeben
wurde, in einem Knettroge durch Handarbeit oder auf mechanischem Wege gemischt. Aus
diesem Troge läuft das flüssige Gemisch durch eine daran befindliche Oeffnung in den
Gährbottich, welcher mehr tief als weit ist und während des Verlaufs der geistigen
Gährung dicht geschlossen gehalten werden muß. Am untern Theil dieses Bottichs ist
ein Hahn angebracht, um das flüssige Gemisch, behufs der Absonderung der Kleien, in
die Siebvorrichtung ablaufen zu lassen können.
Siebvorrichtung. – Der in Fig. 15 im
Längendurchschnitt und in Fig. 16 in der Endansicht
dargestellte Apparat hat sich als zweckmäßig bewährt. Die Siebvorrichtung ruht auf
einem gußeisernen Gerüst a, welches aus zwei Wangen
besteht, die durch Bindestücke b in geeigneter
Entfernung von einander gehalten werden. Auf einer starken Querstange am obern Theil
des Gerüsts ist der hölzerne Cylinder c angebracht, welcher mit eisernen
Reifen gebunden und mit einem hölzernen Hahn d versehen
ist. Im Centrum dieses Cylinders befindet sich eine mit vier Armen e versehene Welle f, welche
von zwei Querstangen, g und h, gehalten wird, die mittelst Riegeln an die Ränder i befestigt sind. Der Welle f wird die Bewegung mittelst einer Kurbel j
mitgetheilt, nämlich durch Scheiben, welche von dem endlosen Riemen k umgetrieben werden, und durch das Zahnrad l, welches in das auf dem obern Ende der Welle
befestigte Rad m greift. Unter dem Cylinder c sind zwei länglich viereckige Siebe n und o, in einem Gestell
p angebracht, welches am einen Ende an zwei Ketten
q aufgehängt ist, und am andern Ende auf zwei
Führern oder Lagern r ruht, unter denen auf der
Kurbelwelle Daumen s angebracht sind, durch welche
dieses Ende des Siebgestelles abwechselnd gehoben und gesenkt wird. Eine starke
Feder u ist an einer vom Gerüst a getragenen Welle angebracht, und ein mit Sperrhaken versehenes Sperrrad
gestattet jener Feder, nach Erforderniß mehr oder weniger Impuls zu ertheilen,
während die Daumen s auf das Siebgestell wirken.
Unter dem Siebgestell ist ein großer Rumpf t angebracht,
welcher die durch die Siebe gehende Flüssigkeit aufnimmt und sie in einen Behälter
leitet.
Man läßt das erwähnte flüssige Gemisch aus dem Gährbottich in den hölzernen Cylinder
c ablaufen, um es darin mittelst der Welle f und ihrer Arme e
umzurühren; nach gehörigem Umrühren öffnet man den Hahn d, und die auslaufende Flüssigkeit verbreitet sich auf dem obersten Sieb
n, welches die gröbste Kleie zurückhält; die
Flüssigkeit tropft dann in das zweite Sieb oder Filter o, welches die kleinsten Kleientheile zurückhält. Der Durchgang der
Flüssigkeit durch die Filter wird durch die schütternde Bewegung befördert, welche
die Daumen dem Siebgestell ertheilen.
Die nächste Operation besteht darin, diejenigen Häutchen oder gröberen Theile, welche
nicht durch das untere Sieb o gehen konnten, mit Zusatz
von Wasser nochmals zu sieben; das dabei erhaltene milchige Wasser wird zum Anteigen
von Grützenmehl für die folgenden Operationen verwendet. Bisweilen werden die Siebe
durch anhängende Klebertheile verstopft; in diesem Falle wasche ich die seidenen
Siebtücher mit gesäuertem Wasser, die Drahtsiebe hingegen mit alkalischem.
Als Patentrecht beanspruche ich:
1) die Darstellung weißen Brodes und Zwiebacks von vorzüglicher Güte, durch Anwendung
des sämmtlichen im Korn enthaltenen Mehles, oder mit anderen Worten, durch Anwendung
solchen Mehles, welches bisher nur sogenanntes Schwarzbrod lieferte;
2) die Anwendung aller derjenigen Theile des Weizenmehls (sogenannte schwarze
Grütze), welche bisher nur braun gefärbtes und grobes Brod lieferten;
3) die Anwendung gesäuerten Wassers, um die milchsaure Gährung, die Färbung etc. zu
verhindern;
4) die Anwendung der geistigen Gährung zur Zerstörung des Ferments, welches sonst die
Veränderungen hervorruft denen die braune Färbung des Brodes hauptsächlich
zuzuschreiben ist;
5) die gänzliche Reinigung des gegohrenen schwarzen Grützenmehls mittelst des
beschriebenen Siebprocesses;
6) das Verfahren zur Wiederbelebung trockener Bierhefe;
7) die beschriebene Siebvorrichtung und die angegebene Methode die Siebtücher vom
anhängenden Kleber zu reinigen;
8) die Anwendung meines Princips auf Korn aller Art, mit welchem Brod bereitet
wird.
Tafeln