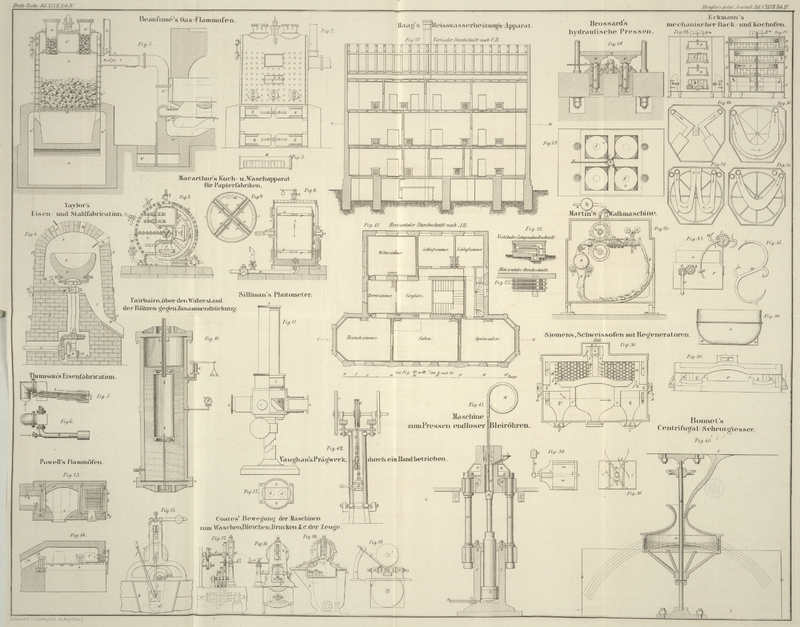| Titel: | Apparat zum Kochen, Bleichen oder Waschen der zur Papierfabrication dienenden Faserstoffe, von Alexander Macarthur, Papierfabrikant zu Dalsham in der Grafschaft Dumbarton. |
| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. LXXIII., S. 260 |
| Download: | XML |
LXXIII.
Apparat zum Kochen, Bleichen oder Waschen der zur
Papierfabrication dienenden Faserstoffe, von Alexander Macarthur, Papierfabrikant zu Dalsham in der Grafschaft Dumbarton.
Aus dem Repertory of
Patent-Inventions, Octbr. 1857, S. 265.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Macarthur's Apparat zum Kochen, Bleichen oder Waschen der zur
Papierfabrication dienenden Faserstoffe.
Fig. 7 stellt
diesen Apparat in der Frontansicht, und zugleich einen Theil des äußeren Gehäuses im
Verticaldurchschnitte dar.
Fig. 8 ist die
Seitenansicht des Apparates, mit Verticaldurchschnitt des äußern Mantels.
Fig. 9 ist ein
Verticaldurchschnitt des innern rotirenden Cylinders. In sämmtlichen Figuren dienen
gleiche Buchstaben zur Bezeichnung der entsprechenden Theile.
Der Apparat besteht aus einem cylindrischen Behälter A,
welcher innerhalb einer geschlossenen Kammer C durch
eine Triebkraft um eine horizontale Welle B in Rotation
gesetzt wird. Dieser Behälter, welcher aus zusammengenieteten eisernen Platten
besteht, ist durch radiale Scheidewände D in vier
Kammern D getheilt. Die zu bearbeitenden Materialien
werden durch seitwärts angebrachte Thüren E in diese
Kammern geworfen. Die Scheidewände D bestehen aus zwei
nahe beieinander angeordneten Platten, welche einen Raum F zwischen sich lassen. Sämmtliche Zwischenräume F öffnen sich am Umfang des rotirenden Behälters in den äußern Behälter C. Die eine Platte jeder Scheidewand ist durchlöchert,
die andere nicht, so daß jede Kammer mit einem Zwischenraume F communicirt. Der Behälter A rotirt in der
durch Pfeile angezeigten Richtung, nämlich so, daß die durchlöcherte Seite jeder
Kammer an der aufsteigenden Seite sich unten befindet. Der äußere Behälter oder
Mantel C wird ungefähr bis zur Höhe G mit heißem Wasser oder der sonstigen für den
vorliegenden Zweck dienenden Flüssigkeit gefüllt.
Wenn nun der Behälter A rotirt, so nimmt jede Kammer
mittelst ihrer durchlöcherten einen Seite eine Quantität dieser Flüssigkeit auf.
Letztere mischt sich mit den in der Kammer befindlichen Materialien und fließt
wieder aus der Kammer, so wie diese über das Niveau G
sich erhebt. Die Materialien werden durch die Rotation des Behälters A mit herumgeführt und überstürzen sich auf der
niedersteigenden Seite. Die Wirkung wird erhöht, wenn man den Behälter A auch nach der entgegengesetzten Richtung in Rotation
setzt. Wenn der Behälter sich so dreht, daß die durchlöcherte Scheidewand D an der aufsteigenden Seite sich unten befindet, so
läuft die Flüssigkeit oder der größere Theil derselben, sobald die Kammer über das
Niveau G sich erhebt, heraus; ist jedoch die
durchlöcherte Scheidewand an der aufsteigenden Seite oben, so wird die Flüssigkeit
mit herumgenommen, und stürzt mit den Materialien auf der absteigenden Seite herab,
wobei sie die Stärke des Falles bedeutend vermehrt. Die Rotation des Behälters A veranlaßt ein wechselndes Ein- und Ausströmen
der Flüssigkeit, wodurch der Proceß des Waschens und Reinigens sehr befördert wird.
Sand und Unreinigkeiten entweichen am Umfang des Behälters A aus den Zwischenräumen F und sinken auf den
Boden des Behälters C. An den Boden des Behälters C schließt sich eine Röhre H, um die Flüssigkeit und den Absatz hinwegzuführen. Von dieser Röhre
erstreckt sich ein Seitenarm J bis zur Höhe des
Wasserstandes in C. Die Röhre H ist ferner mit einem Hahn I versehen,
welcher geschlossen ist, ausgenommen wenn der Inhalt des Behälters C abgelassen werden soll. Ist der Hahn I geschlossen, und der Hahn K der Röhre J offen, so muß für die über das
Niveau im Behälter sich erhebende Flüssigkeit eine entsprechende Portion, vom Boden
anstatt von der Oberfläche aus, durch I abfließen. In
den Behälter C mündet sich ferner unterhalb des
rotirenden Behälters A und des Wasserniveau's eine mit
einem Hahn versehene Röhre L, um Dampf in den Behälter
zu leiten. Damit dieses in Gestalt zahlreicher Ströme geschehe, ist die
Röhrenmündung siebartig durchlöchert.
Eine an der andern Seite des Behälters angebrachte Röhre M dient zur Herbeiführung der zum Bleichen oder Reinigen dienenden
Flüssigkeit.
Zu dem Ende ist die Röhre M mit einem Trichter N und einem Hahn versehen. An einer höher gelegenen
Stelle des Behälters C ist eine Röhre O nebst Hahn angebracht zur Einführung von Chlorgas. Ein
kleiner Probehahn P dient zur Untersuchung des Zustandes
im Innern des Behälters. Q ist ein Sicherheitsventil
gegen zu hohe Dampfspannung. Braucht man Dampf von höherem als atmosphärischem
Drucke, so schließt man die Hähne I, K, O, P und den der
Röhre M.
Bei der Papierfabrication ist es seither gebräuchlich gewesen, die Operationen des
Kochens, Waschens und Bleichens in verschiedenen Behältern oder Apparaten
vorzunehmen, während bei dem beschriebenen Apparat diese verschiedenen Proceduren
hintereinander in einem einzigen Behälter vor sich gehen, was eine Ersparniß an Zeit
und Kosten gewährt. – Patentirt in England am 10. December 1856.
Tafeln