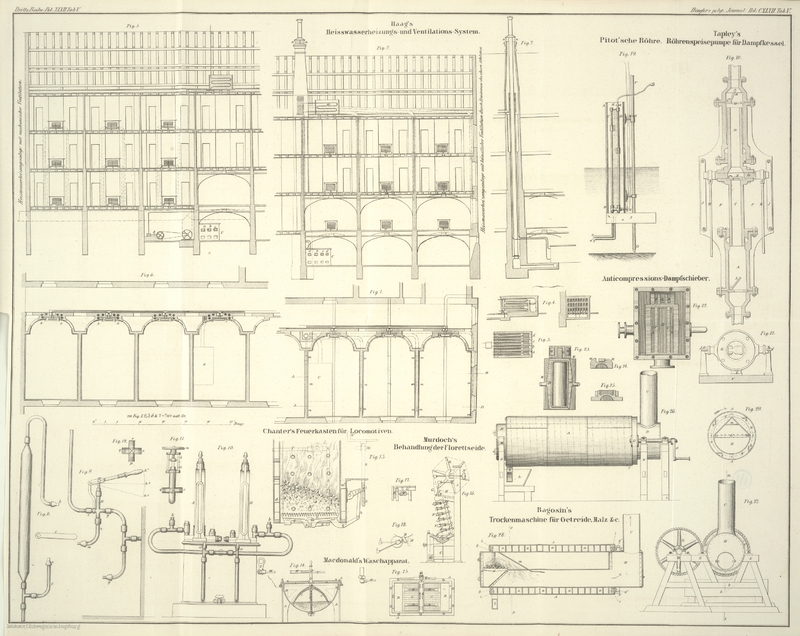| Titel: | Verbesserungen an Waschmaschinen, von David Macdonald, Fabrikant zu Glasgow. |
| Fundstelle: | Band 147, Jahrgang 1858, Nr. CI., S. 339 |
| Download: | XML |
CI.
Verbesserungen an Waschmaschinen, von David Macdonald, Fabrikant zu Glasgow.
Aus dem Repertory of
Patent-Inventions, Sept. 1857, S. 184.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Macdonald's Verbesserungen an Waschmaschinen.
Diesen, am 26. December 1856 in England patentirten Waschapparat stellt Fig. 14 im
Verticaldurchschnitt, Fig. 15 im Grundrisse
dar. Die Wasch- oder Bleichkammer B, welche auf
einem länglich viereckigen Gestell A ruht, ist von
halbcylindrischer Form und mittelst einer Flantsche an das Gestell A festgeschraubt. Innerhalb der Kammer befindet sich ein
beweglicher Behälter C, welchem eine oscillirende
Bewegung mitgetheilt wird. Die Kammer C hat die Gestalt
eines umgekehrten Schiffs, und hängt mit ihrem offenen Theil abwärts; sie ist an
eine horizontale Achse E befestigt, welche durch die
Kammer B sich erstreckt und in dem Gestell A gelagert ist. Durch eine Scheidewand F ist die Kammer C in zwei
besondere Abtheilungen getheilt. Das Holzwerk, woraus die Kammer C besteht, ist durchlöchert, um den bleichenden oder
reinigenden Flüssigkeiten eine freie Circulation zu gestatten. An dem einen Ende der
horizontalen Achse E ist ein verticaler Hebel G angebracht, welcher mit Hülfe der in den Zapfen der
Kurbelwelle I eingehängten Verbindungsstange H in hin- und hergehende Bewegung gesetzt wird.
Die Stange H ist an ihrem Ende mit einer Handhabe
versehen, und besitzt einen Einschnitt, der sich in einen seitwärts vom verticalen
Hebel G herausragenden Zapfen legt, so daß man durch
einfaches Aufheben der Stange H jeden Augenblick im Stande ist die Kammer
C außer Thätigkeit zu setzen. Um das Herausspritzen
der reinigenden Flüssigkeiten zu verhüten, ist die Kammer B durch ein paar Deckel K geschlossen. Zu dem
Ende sind die Deckel mit Schlitzen versehen, aus welchen beim Niederklappen die von
den Flantschen der Waschkammer B emporragenden Ringe L heraustreten. Durch diese wird alsdann eine Stange
geschoben. Die in den Apparat geschaffte Flüssigkeit kann durch die Röhre M abgelassen werden. Diese Röhre kann auch benützt
werden, um zur Beförderung des Reinigungsprocesses einen Dampfstrom von unten in die
Kammern C zu leiten.
Um die beiden Kammern C mit der zu reinigenden Wäsche zu
füllen, hängt der Arbeiter die Verbindungsstange H aus
und drückt den Verticalhebel G herab, wodurch die
Scheidewand F nahezu in horizontale Lage gelangt und die
eine oder die andere Kammer aus dem Behälter B
heraustritt. Der Hebel G wird alsdann wieder mit der
Stange H in Verbindung gebracht und die Kurbelwelle I in Notation gesetzt, in deren Folge die Kammer C eine pendelartig schwingende Bewegung annimmt.
Durch diese oscillirende Bewegung wird die Wäsche tüchtig geschüttelt und
durcheinander gearbeitet, die Falten werden gelockert und sämmtliche Flächen der
reinigenden Wirkung der Flüssigkeiten ausgesetzt. Der durch die Röhre zugelassene
Dampf befördert die Operation bedeutend; er begünstigt das Oeffnen der Fasern und
dient zugleich zur Erhöhung der Temperatur der Flüssigkeit.
Man kann die Materialien während der Operation des Bleichens auch einem Luftstrom
aussetzen. Nachdem sie nämlich in dem obigen Apparate gewaschen worden sind, bleicht
man sie mit Hülfe der üblichen chemischen Agentien; die Einwirkung der letzteren
wird jedoch bedeutend erhöht, wenn man die in der Bleichkammer befindlichen Stoffe
einem mittelst eines Ventilators in die Kammer getriebenen kalten
(kohlensäurehaltigen) Luftstrom aussetzt. In einigen Fällen kann ein Strom erwärmter
Luft wirksamer befunden werden als kalte Luft. Den Schluß der Operationen des
Reinigens und Bleichens bildet das Auswaschen in reinem Wasser.
Tafeln