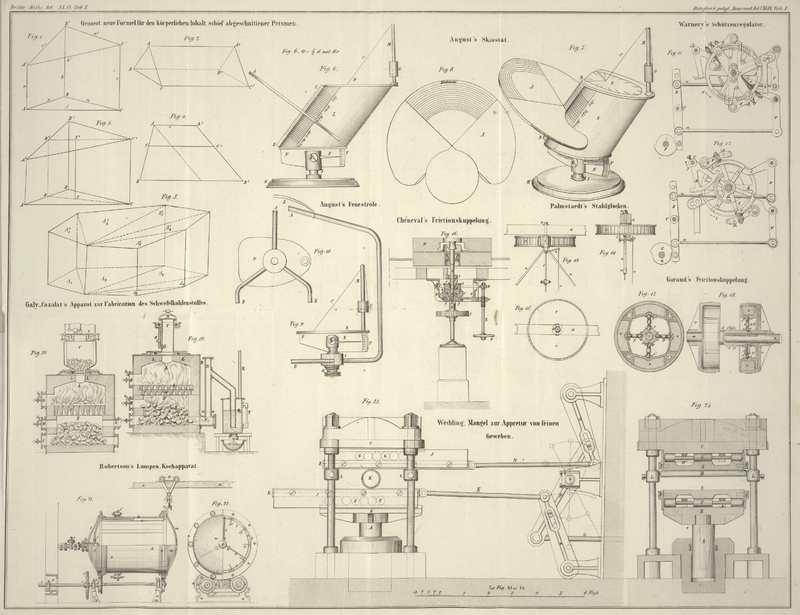| Titel: | Frictionskuppelung von Florentin Garand in Paris. |
| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. VI., S. 22 |
| Download: | XML |
VI.
Frictionskuppelung von Florentin Garand in
Paris.
Aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure,
1858, Bd II. S. 133.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Garand's Frictionskuppelung.
Das Eigenthümliche dieser, im London Journal of arts,
Januarheft 1858 S. 26 beschriebenen und für England patentirten Vorrichtung besteht
darin, eine Welle vermittelst Benutzung der Friction nach beliebiger Richtung hin in
Umdrehung versetzen und diese Bewegung plötzlich aufheben oder umkehren zu
können.
Fig. 17 zeigt
die Kuppelung im Querschnitt, Fig. 18 theilweise in der
Seitenansicht, theilweise im Längendurchschnitt. Auf der zu treibenden Welle a befinden sich in einiger Entfernung von einander die
beiden Riemscheiben c, c lose auf derselben und sind
mittelst Riemen mit der Hauptbetriebswelle in Verbindung gesetzt, so daß sie sich
also bei Benutzung eines offenen und gekreuzten Riemens stets in entgegengesetzter
Richtung auf der Welle bewegen. Zwischen jenen beiden Riemscheiben befindet sich,
durch eine Feder mit der Welle verbunden, ein Muffe d,
den man mittelst
eines in die ringförmige Nuth b eingreifenden Hebels auf
der Welle ihrer Längenrichtung nach verschieben kann. Auf derselben Welle, mit ihr
durch einen Keil fest verbunden, sitzen innerhalb jeder Riemscheibe die beiden
Scheiben h und h', von etwas
geringerem Durchmesser als der innere Durchmesser der ersteren, und tragen an ihrem
Umfang kastenförmige Behälter, in denen sich die Schieber e,
e, bestehend aus einem eisernen Gehäuse und einem darin passenden, der
Kreisform der Riemscheibe sich anschließenden Holzklotz, in radialer Richtung dem
Mittelpunkt näher und weiter bringen lassen. Indem man nun die Schieber e, e, deren hier vier vorhanden sind, gegen den inneren
Rand der Riemscheibe drückt, wird die Kuppelung durch die Reibung bewirkt und die
Welle a in Bewegung gesetzt. Das Hinaustreiben der
Schieber gegen die Riemscheibe geschieht durch entsprechende als Kniehebel wirkende
Gelenkstücke g. Dieselben, bestehend aus je zwei an
ihrem einen Ende mit einem kugelförmigen Zapfen versehenen Schrauben mit
Links- und Rechtsgewinde f, f' und darüber
geschraubter Mutter g, sitzen mit einem Ende in einer
entsprechenden Vertiefung der Schieber e, mit dem andern
in einer eben solchen des Muffes d, und es ist ihre
Länge mittelst der Mutter so bemessen, daß sie bei mittlerer Stellung des Muffes d in schräger Lage sich befindend, die Schieber e und demnach auch die darin enthaltenen Bremsklötze in
einiger Entfernung von der Riemscheibe erhalten und so die Welle a in Ruhe lassen. Rückt man indeß den Muff d nach links oder rechts, drückt also mittelst jener
Gelenkstücke die Frictionsklötze gegen die Riemscheibe, so wird der Scheibe h oder h' und durch sie der
Welle a die entsprechende Bewegung mitgetheilt, die sich
leicht entweder wieder aufheben oder in die entgegengesetzte umwandeln läßt.
(Der Effect der mitgetheilten Frictionskuppelung ist sehr beachtenswerth und weit
größer, als derjenige einer Frictionskuppelung mit zwei abgekürzten eisernen Kegeln,
ohne mit den Uebelständen verbunden zu seyn, welche eine Steigerung des Effects der
letzteren über eine gewisse Gränze verhindern und welche darin bestehen, daß eine zu
spitze Form der Kegel ein Klemmen verursacht, welches die Lösung der Kuppelung
erschwert, und daß ein zu großer, Reibung erzeugender, Normaldruck eine zu große
Abnutzung zur Folge hat. Die Lösung ist bei der hier beschriebenen Kuppelung ohne
Zweifel sehr leicht, da die reibenden Klötze in normalen Richtungen von der
Reibungsfläche zurückgezogen werden, und die Abnutzung ist hier weniger schädlich,
da die Holzklötze leicht durch neue ersetzt werden können.
Bezeichnet P den Druck, durch welchen der Muff
vorgeschoben wird, a den sehr spitzen Winkel, den jedes
der vier Gelenkstücke mit einer zur Wellenachse senkrechten Ebene bildet, so ist der radiale
Druck der vier Klötze gegen die Innenfläche der Riemscheibe zusammen = P cotg α, also, wenn r der Radius dieser cylindrischen Innenfläche ist, das erzeugte
Reibungsmoment
M = μP cotg α
. r.
Dagegen ist bei einer conischen Frictionskuppelung, wenn a und b die äußersten Radien sind und α' der Winkel zwischen den Seiten der Kegelfläche
und ihrer Achse ist,
M' = μ'P 1/(sin α') 2/3 (a³ – b³)/(a² – b²)
oder, wenn a = r (1 + n), b = r (1 – n) gesetzt wird:
M' = μ'P r/(sin α') (1 ± n²/3) = μ'P r/(sin α') nahezu.
Es verhält sich also bei gleichem Druck P und gleichem
mittleren Radius r
M : M' = μ/tg α : μ'/sin α',
oder, da man aus den oben erwähnten Gründen a' = 60° etwa zu machen pflegt, während a leicht = 10° gemacht werden kann, und weil auch
der Reibungscoefficient μ von Holz auf Eisen
wenigstens doppelt so groß ist als derjenige μ'
von Eisen auf Eisen:
M : M' =
10 : 1.)
Tafeln