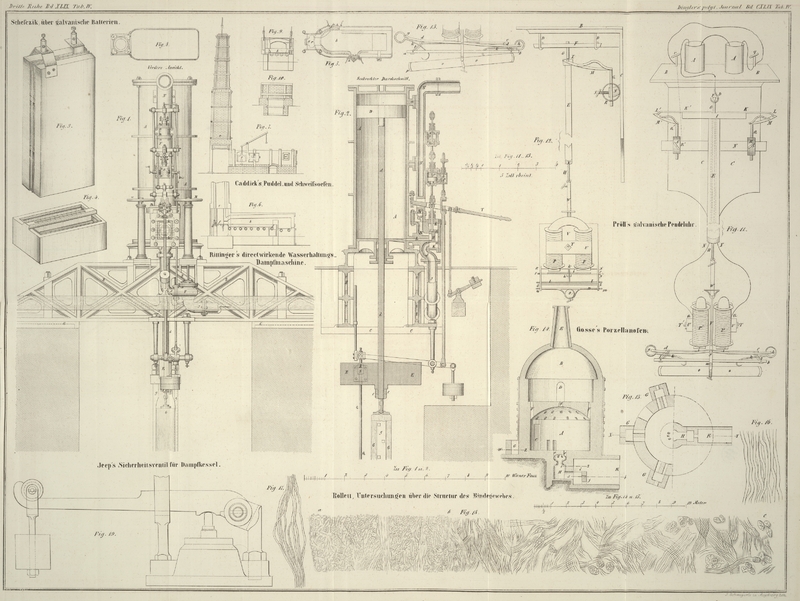| Titel: | Zur Theorie der Gerberei. – Untersuchungen über die Structur des Bindegewebes; von Dr. Alexander Rollett, Assistent bei der physiologischen Lehrkanzel der Wiener Universität. |
| Fundstelle: | Band 149, Jahrgang 1858, Nr. LXXXIX., S. 298 |
| Download: | XML |
LXXXIX.
Zur Theorie der Gerberei. – Untersuchungen
über die Structur des Bindegewebes; von Dr. Alexander Rollett, Assistent bei der physiologischen
Lehrkanzel der Wiener Universität.
Auszug seiner Abhandlung im
XXX. Bande, Nr. 13, des Jahrganges 1858 der Sitzungsberichte der mathem. naturw. Classe der kaiserl. Akademie der
Wissenschaften.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Rollett, über die Structur des Bindegewebes.
Ich lernte im Kalkwasser eine Flüssigkeit von
eigenthümlicher Wirkung auf bindegewebige Texturen kennen und dem Kalkwasser
gesellte sich auf Anrathen meines verehrten Lehrers, des Hrn. Professors Brücke, das ähnlich aber energischer wirkende Barytwasser bei.
Legt man ein Stück Sehne vom erwachsenen Menschen in Kalkwasser und läßt es darin
durch 6–8 Tage oder noch länger liegen, so bemerkt man an demselben keine
andere Veränderung, als daß die peripherischen Partien desselben ein wenig
durchscheinend werden.
Bringt man aber einen der cylindrischen Stränge, welche die Sehne zusammensetzen, auf
ein Objectglas und übt auf die Flanken jenes Stranges etwa in der Mitte seiner Länge
auch nur einen sehr mäßigen, zur Längsrichtung senkrechten Zug nach
entgegengesetzten Seiten aus, so breitet sich derselbe in dem durch die auseinander
gezogenen Präparirnadeln abgemarkten Raume zu einer Lage von theils gröberen, theils
feineren, theils sehr feinen Fäden aus, von denen die zuletzt genannten durch eine
Auffaserung der ersteren sich herstellen.
Es liegen diese Fäden auf verschiedene Weise über einander und indem sie nach
entgegengesetzten Richtungen hin verlaufen, kreuzen sie sich unter spitzen Winkeln.
Durch die zwischen ihnen vorhandenen Räume sieht man direct auf die Oberfläche des
Objectglases.
Das Barytwasser verändert schon in kürzerer Frist, etwa nach 4–6 Stunden, die
Sehnen in derselben Weise, wie dieß durch das Kalkwasser geschieht. Nur werden die
Sehnenstücke im Barytwasser im höheren Maaße durchscheinend. In dieser letzteren
Flüssigkeit quellen auch die Sehnen etwas mehr an als im Kalkwasser, es ist aber das
Quellungsmaximum der Sehnensubstanz weder für das Barytwasser, noch für das
Kalkwasser bedeutend größer, als für gemeines Wasser, und die Volumsveränderung der
eingelegten Sehnenstücke in beiden Fällen keine beträchtliche.
So wie an dem Bindegewebe der Sehnen, so wird auch an dem Bindegewebe anderer Gebilde
durch die Behandlung mit Aetzkalk oder Aetzbaryt der Zusammenhang des leimgebenden
Stromas gelockert, ich werbe von den dabei stattfindenden Eigenthümlichkeiten später
handeln.
Das Kalk- oder Barytwasser verändert die morphologische Beschaffenheit des
Bindegewebes nicht, es greift die leimgebende Masse des Bindegewebes nicht an,
lockert aber den festen Zusammenhang derselben auf und gestattet die Isolirung
faseriger Formelemente aus derselben.
Eine weitere Untersuchung ergibt, daß während sich jene Abänderung der mechanischen
Verhältnisse des Bindegewebes herstellt, in das Kalk- oder Barytwasser eine
geringe Menge einer Substanz übergeht, welche durch Säuren wieder aus jenen
alkalischen Flüssigkeiten herausgefällt werden kann.
Mit der Anwesenheit jener Substanz im Bindegewebe fällt also das innige
Aneinanderhaften der Formbestandtheile desselben zusammen.
Um sich von den angegebenen Thatsachen zu überzeugen, benütze man Bindegewebe in
seiner reinsten Form, also Stücke, die aus dem Verlauf größerer frischer Sehnen
herausgeschnitten wurden. Legt man dieselben in eine nicht zu große Menge von
Kalk- oder Barytwasser ein, und untersucht diese Flüssigkeiten nachdem sie 24
Stunden über den Sehnen gestanden hatten, so findet man, daß sie sich durch Zusatz
von Essigsäure, verdünnter Chlorwasserstoffsäure oder Salpetersäure trüben und sich
ein flockiger Niederschlag daraus absetzt.
Hat man mit verdünnter Salpetersäure gefällt und diese im Ueberschuß zugesetzt so
sieht man, wenn man das Ganze erhitzt, daß in der Flüssigkeit eine blaß citrongelbe
Farbe entsteht, die, wenn man in die abgekühlte Flüssigkeit Ammoniak bringt, in die
schön gelbe Farbe des ranthoproteinsauren Ammoniaks übergeht. Diese Reaction kann
man auch benützen um geringere Mengen jenes Eiweißkörpers im Kalk- oder
Barytwasser nachzuweisen.
Der auf den Zusatz einer Säure entstehende Niederschlag ist mehr oder weniger
reichlich, je nach dem Verhältniß der verwendeten Sehnen zur Menge des angewendeten
Kalk- oder Barytwassers, d.h. nach dem Grade der Sättigung jener alkalischen
Flüssigkeiten mit der darin löslichen Substanz.
Zieht man eine beliebige Menge kurz abgeschnittener Sehnenstücke mit Kalk-
oder Barytwasser aus und erneut diese Flüssigkeiten ein oder mehreremale, so geht
bald nichts mehr weiter aus den Sehnenstücken in die alkalischen Lösungen über.
Es ist wahrscheinlich, daß jener Eiweißkörper, an dessen Anwesenheit im Bindegewebe
das feste Aneinanderkleben der leimgebenden Formelemente geknüpft ist, auch noch von
anderen Lösungsmitteln, z.B. von verdünnten Mineralsäuren oder verdünnten Lösungen
der eigentlichen Alkalien, angegriffen wird.
Aber alle diese Lösungsmittel bewirken auch ein bedeutendes Aufquellen der
leimgebenden Masse des Bindegewebes, so daß dieselbe, wie bekannt, in eine
durchscheinende Gallerte verwandelt wird, an welcher die mikroskopischen Charaktere
des Bindegewebes vollkommen verwischt erscheinen; der Umstand, daß ein solches
Anquellen der leimgebenden Substanz des Bindegewebes nach der Anwendung des
Kalk- oder Barytwassers nicht stattfindet, macht diese Flüssigkeiten eben zu
so schätzenswerthen Untersuchungsmitteln des Bindegewebes.
Reißt man aus einem Stück Rindleder einen jener cylindrischen Stränge, welche der
Fleischseite desselben das bekannte filzige Ansehen ertheilen, mittelst einer
Pincette heraus und untersucht ihn mikroskopisch, so sieht man, daß derselbe alle
Verhältnisse des frischen Bindegewebes, aber auf die deutlichste Weise ausgeprägt an
sich erkennen läßt.
Jeder solche Strang (Fig. 16) besteht aus einem Bündel von Bindegewebsfasern, deren neben
einander liegende Contouren das längsgestreifte Ansehen jenes Stranges
hervorbringen, und zerlegt man einen solchen Strang in jene leicht isolirbaren
Fasern, so sieht man, daß diese vollkommen glattrandige durchsichtige Cylinder von
gleichmäßigem Durchmesser darstellen.
Nachdem ich diese Erfahrung gemacht hatte, schien es mir überhaupt ersprießlich das
Leder einer genaueren Untersuchung zu unterwerfen, indem die Textur des Bindegewebes
in demselben vollständig erhalten war, man aber in der gerbsauren Collagensubstanz
ein Object vor sich hat, welches von anderen durch seine Starrheit und die Prägnanz
seiner Verhältnisse eben so vortheilhaft verschieden ist, als die meisten
pflanzenanatomischen Objecte von denen der Thierhistologie.
Es kam mir nun zunächst darauf an zu untersuchen, welchen Einfluß die bis zur
vollendeten Gerbung der Haut wirksamen Processe auf das Bindegewebe ausüben.
Ich habe schon oben die Einwirkung des Kalkwassers auf bindegewebige Texturen
besprochen. Hier muß ich erwähnen, daß die Behandlung der zu gerbenden Häute mit Kalk in Substanz bis in die frühesten Zeiten der Gerberei
zurückreicht.
Der erste, welcher die Anwendung des Kalkwassers
einführte, war A. Seguin,Leliévre et Pelletier: Rapport au
comité de salut public sur les nouveaux moyens de tanner les
cuirs, proposés par le citoyenArmand Seguin, aus dem Journal des arts et manufactures, Paris,
Anneé 4. übersetzt in Hermbstädt's Journal, Berlin 1802, Bd. I, S. 187. derselbe welcher mit Lavoisier über die
Respiration experimentirte und die Abhandlung über Hautsecretion und den Einfluß der
Bäder schrieb.
Er erfand zur Zeit des Wohlfahrts-Ausschusses die Schnellgerberei.
Man gibt an, daß die Häute zum Zwecke des Enthaarens gekalkt werden, und allerdings
lösen sich die Haare und nicht nur diese, sondern die sämmtlichen Oberhautgebilde
von einer in Kalkwasser eingelegten Haut mit der größten Leichtigkeit ab.
Daß aber die Enthaarung und Befreiung der Haut von der Epidermis nicht der alleinige
Grund des Kalkens seyn können, hat schon Hermbstädt
Chemisch-technologische Grundsätze der gesammten Ledergerberei. Berlin
1807, Bd. II S. 210. auseinandergesetzt. Er sagt daß die Häute, um gutes und geschmeidiges Leder
zu liefern, länger im Kalkwasser zubringen müssen, als zu ihrer Enthaarung
nothwendig ist, und hat sogar aus dem Kalkwasser mit dem er Stückchen Rinderhaut
durch 14 Tage behandelt hatte, mittelst Salzsäure eine Masse herausgefällt, über
deren Natur er aber sehr unrichtige Vorstellungen hatte, indem er sie für ein aus
einer löslichen Kalkseife abgeschiedenes Fett hielt.
Man überzeugt sich durch Untersuchung des zur Extraction eines Hautstückes
verwendeten Kalkwassers leicht, daß eine Eiweißsubstanz in dasselbe übergegangen
ist, die so wie sie zwischen die Formbestandtheile des Bindegewebes eingelagert ist,
wahrscheinlich auch zwischen dem Corium und den Oberhautgebilden sich befindet.
Ich kehre nun zu dem im Kalkwasser liegenden Hautstücke zurück.
Die Oberhaut läßt sich in einigen Tagen von demselben abstreifen. Ueberzeugt man
sich, daß schon eine ziemliche Menge jener Eiweißsubstanz in das Kalkwasser
übergegangen ist, so kann man dasselbe erneuen um das Hautstück möglichst
vollständig auszuziehen. Nachdem es der Einwirkung der alkalischen Flüssigkeit im
Ganzen acht Tage lang ausgesetzt war, bringt man es, um den Kalk daraus zu
entfernen, in schwach angesäuertes Wasser.
Die vollständige Entfernung des Kalkes ist unumgänglich nothwendig, damit man bei der
nachfolgenden Behandlung der Haut mit Tannin nicht einen guten Theil der
Wirksamkeit des letzteren vernichte, indem sich, wenn Kalk im Ueberschuß in die
gerbsaure Lösung gelangt, ein körniger Niederschlag von unlöslichem
basisch-gerbsaurem Kalk bilden würde, im umgekehrten Falle aber bei
überschüssigem Tannin zwar eine lösliche Verbindung von neutralem gerbsaurem Kalk
entstehen würde, die aber keine gerbenden Eigenschaften hat.
Ist also die Haut vom Kalke vollkommen befreit, so bringe man sie in eine mit
schwacher Tanninlösung gefüllte Flasche. Man prüfe gleichzeitig ein wenig jener
Lösung durch Hinzutropfen von Leimlösung auf den beiläufigen Gerbsäuregehalt.
Die thierische Haut zieht bald allen Gerbestoff vollständig an sich. Pelouze
Annales de Chimie et de Physique, December 1833,
S. 337; polytechn. Journal Bd. LII S.
302. hat diese Eigenschaft der thierischen Haut sogar benutzt, um aus einem
Gemenge von Gerb- und Gallussäure die erstere vollständig zu entfernen, und
aus der Gewichtszunahme der benützten Haut quantitativ zu bestimmen.
Man prüfe daher, nachdem man die Haut in die Tanninlösung eingelegt hat, diese
letztere von Zeit zu Zeit auf ihren Gehalt an Gerbsäure durch Hinzutropfen von
Leimlösung und setze, so oft man bemerkt daß die Gerbsäure aus der Flüssigkeit
verschwunden ist, eine neue Menge zu, so lange bis das neu hineingebrachte Tannin
nicht mehr absorbirt wird. Man lasse endlich das Hautstück so lange in der
gerbsäurehaltigen Flüssigkeit liegen, bis eine Probe desselben, die man mit Wasser
abgespült und dann getrocknet hat, alle Eigenschaften des Leders zeigt.
Ich will zuerst, weil die Verhältnisse, der mangelnden Papillen halber, dort sich
einfacher darstellen, mit dem Rindleder beginnen. Es ist einerlei ob man käufliches
Kuh- und Kalbleder verwendet oder solches, welches man selbst gegerbt hat;
ich habe mich überzeugt, daß sich letzteres in nichts von dem käuflichen
unterscheidet als in der Farbe, welche bei dem einen bekanntlich die eigenthümliche
Farbe der Lohe, bei dem andern nur ein lichtes Graubraun ist.
Hat man aus einem Stück Kalbleder senkrecht zur Oberfläche stehende, sonst beliebig
gerichtete Durchschnitte angefertigt, um sie mikroskopisch zu untersuchen, so ist es
am besten dieselben mit Terpenthinöl zu tränken. Will man die Präparate längere Zeit
aufbewahren und besonders schön und durchsichtig erhalten, so wende man die kürzlich
von Brücke
Untersuchungen über den Bau der Muskelfasern, welche mit Hülfe des
polarisirten Lichtes angestellt wurden. (Denkschriften d. kais. Akademie d.
Wissenschaften 1857, Bd. XV.) für die Muskeln
angegebene Methode an, man verdränge das Terpenthinöl mit Dammarfirniß und schließe
die Schnitte in dem letzteren ein.
An einem solchen Lederschnitte, Fig. 18, fallen zunächst
zwei Schichten in die Augen, deren Abgränzung von einander, so entschieden sie auch
hervortritt, doch nicht durch einen zwischen beiden Schichten hinlaufenden Contour
hervorgebracht wird.
Diejenige Schichte, welche der freien Oberfläche des Corium zugekehrt war, hat eine
geringere Breite als die unter ihr liegende, und bietet wegen der größeren Menge der
in ihr enthaltenen und die Zeichnung des Objectes gegen den lichten Grund
abgränzenden scharfen Contouren ein etwas dunkleres Ansehen dar, als die
letztere.
Die innere dieser Schichten besteht aus verschieden dicken Bündeln der oben näher
beschriebenen Fasern. Diese Bündel laufen im Allgemeinen der Oberfläche des Corium
parallel und steigen nur in allmählicher Neigung gegen dieselbe auf. Sie
durchkreuzen sich unter spitzen Winkeln. Kurz es ergibt sich hier derselbe Befund,
welcher sich auch am frischen Corium ganz leicht ermitteln läßt und längst bekannt
ist.
Anders verhält es sich mit der äußeren Schichte.
Die Untersuchung des gegerbten Corium ist geeignet, uns über das leimgebende Stroma
jener Schichte einen ganz gründlichen Aufschluß zu geben.
Kann man den Durchtritt eines Bindegewebbündels der inneren Coriumschichte durch die
oben angeführte Gränze zur äußeren Schichte verfolgen (und das ereignet sich fast
jedesmal an der einen oder der andern Stelle eines Lederdurchschnittes), so nimmt
man wahr, daß jenes Bündel sich auflöst, und zwar zerfährt es in jene constanten
Elemente, die man, jedesmal bei der Auffaserung eines aus dem Lederfilz
herausgerissenen Fadens erhält.
Durch die Zwischenräume der von jenem Bündel ausgehenden Fasern oder Faserpartien
flechten sich die in den Schnitt gefallenen Segmente gleichartiger Fasern in den
verschiedensten Richtungen hindurch, und diese innige Durchflechtung von kürzeren
oder längeren im Längsschnitt sichtbaren Fasern mit queren und schrägen
Faserdurchschnitten wiederholt sich, den eigenthümlichen optischen Eindruck der
äußeren Coriumschicht hervorrufend, bis an die Oberfläche der Lederhaut hin. Der
scharfe Rand, welcher jenen Theil des Durchschnittes gegen den Grund des Sehfeldes
absetzt, ist selbst wieder aus den scharfen Contouren der oberflächlichst liegenden
Fasern zusammengesetzt.
Man überzeugt sich also an solchen Lederdurchschnitten auf die schönste Weise davon,
daß das Hauptlager der Lederhaut aus vielfach durchflochtenen Bindegewebbündeln besteht,
während im peripherischen Theile des Corium die faserigen Elemente jener Bündel sich
auseinanderlegen, untereinander sich durchflechten und so die eigenthümliche
Beschaffenheit jener Gränzschichte zu Stande bringen.
Man bedient sich schon seit langer Zeit verschiedener chemischen Agentien um das
Bindegewebe in eine aufgequollene durchsichtige Masse zu verwandeln.
Solche Agentien sind die Essigsäure, sehr verdünnte Salz- oder Salpetersäure
oder die Lösungen der reinen Alkalien.
Wenn ein Stückchen einer Sehne in sehr verdünnter Salzsäure (1 p. m.) angequollen ist, so stellt dasselbe eine durchscheinende zähe und
klebrige Masse dar.
Interessant ist es, daß das Bindegewebe in dem durch die Quellung erworbenen
scheinbar structurlosen Zustande fixirt werden kann.
Wenn man eine in verdünnter Salzsäure angequollene Sehne in Tanninlösung bringt, so
schrumpft sie nicht zusammen, sondern wird im aufgequollenen Zustande in eine spröde
Masse umgewandelt.
In der Gerberei macht man von der Wechselwirkung zwischen dem aufgequollenen
Bindegewebe und dem Tannin schon lange Gebrauch.
Nicht bloß um den Kalk aus den Häuten zu entfernen, sondern auch um die Häute zu
„treiben“ oder zu „schwellen,“ wie man
sich ausdrückt, werden die zu Sohlleder zu verarbeitenden Häute in ein durch sauer
gährenden Gerstenschrot oder Weizenkleie erzeugtes Sauerwasser gelegt, sondern auch
um daraus ein dickeres Leder zu gewinnen.
Erklärung der Abbildungen.
Fig. 16
Bindegewebbündel aus dem Kuhleder, 600mal vergrößert.
Fig. 17
isolirte Fasern aus dem Kalbleder, 300mal vergrößert.
Fig. 18
Durchschnitt durch käufliches rohes Kalbleder, a
– b äußere Schichte des Corium, b – c innere Schichte
des Corium. Vergrößerung 300mal. Die Dicke des Leders betrug 1,8 Millim., deren
300malige Linearvergrößerung daher 54 Centim. Es sollten daher von c an noch 20 Centim. gezeichnet seyn.
Tafeln