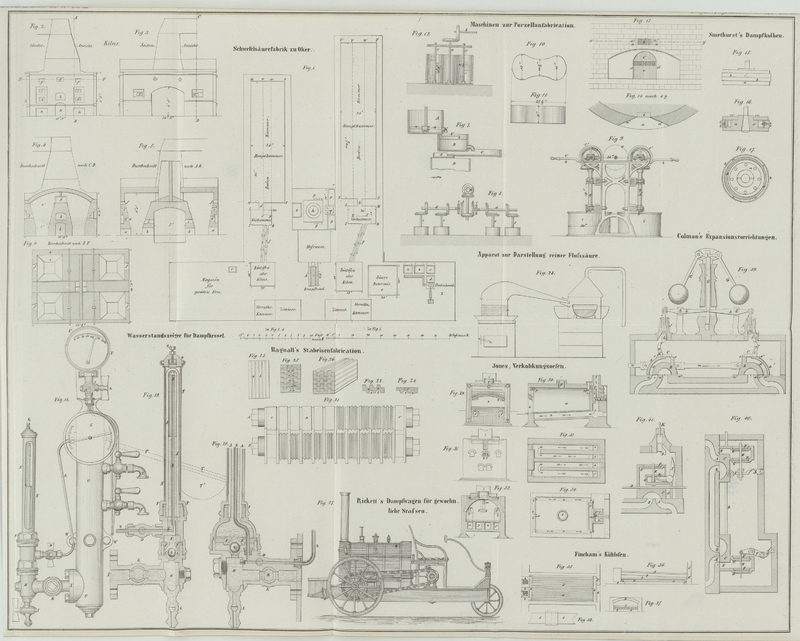| Titel: | Darstellung von Schwefelsäure beim Rösten von Kupfererzen in Schachtöfen zu Oker; von W. Knocke. |
| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. XLI., S. 181 |
| Download: | XML |
XLI.
Darstellung von Schwefelsäure beim Rösten von
Kupfererzen in Schachtöfen zu Oker; von W. Knocke.
Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1859,
Nr. 40 und 43.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Knoche über Darstellung von Schwefelsäure beim Rösten von
Kupfererzen in Schachtöfen zu Oker.
Sämmtliche Erze des Rammelsberges (Kupfererze, Bleierze und aus beiden melirte Erze)
werden vor ihrer Verschmelzung einer dreimaligen Röstung, das erste Mal in freien
Haufen und die beiden andern Male unter Schuppen bei Holzfeuerung unterworfen, und
bei der ersten Röstung pp. 1 Proc. des in den Erzen
vorhandenen Schwefels in Substanz gewonnen, dessen Werth die Kosten der Röstung
reichlich deckt.
Die zunehmende Schwierigkeit, das zur Röstung erforderliche fichtene Scheitholz
herbeizuschaffen, so wie die immer mehr sich verbreitende Anwendung der
Schwefelsäure zu industriellen Zwecken führten den verstorbenen Vitriolmeister Benecke auf die Idee, die Rammelsbergischen Erze auf
Schwefelsäure zu benutzen. Derselbe hatte in England Gelegenheit gehabt, die
Darstellung dieser Säure durch Abrösten von Schwefelkiesen zu sehen, und da er die
hiesigen Erze den dort angewandten ähnlich fand, so erbaute man, nachdem im Kleinen
gemachte Versuche zur Zufriedenheit ausgefallen waren, im Jahre 1841 hierselbst die
erste Schwefelsäurefabrik.B. Kerl, die Rammelsberger Hüttenprocesse, 1854.
S. 155. – Derselbe, der
Communion-Unterharz. Freiberg, 1853, S. 65.
Die Röstung der Erze geschah in dieser anfangs in einem sogenannten englischen Ofen
auf Charmotteplatten, die durch Steinkohlen erhitzt wurden; die nöthige
Salpetersäure entwickelte man aus Chilisalpeter oder auch aus Kalisalpeter, den man
in Quantitäten von 5 Pfd., mit 5 Pfd. Schwefelsäure von 50° B. in einem
eisernen Kasten übergossen, in Canäle stellte, die an der Hinterwand des Ofens
befindlich waren. Die entwickelten Gase, schweflige Säure und Salpetersäure, leitete
man durch ein Porzellanrohr gemeinschaftlich in die Kammern. Man röstete in diesem
Ofen in 24 Stunden 7 Scherben Erz (à 4 Kubikfuß
526,5 Kubikzoll oder 4 1/2 Ctr.) mit 6 bis 7 Balgen Steinkohlen (à 2 1/2 Kubikfuß), und brauchte in derselben Zeit
54 Pfd. Salpeter. Wegen der bedeutenden Nachfrage nach Schwefelsäure wurde die
Fabrik im Jahre 1849 durch die Anlage eines neuen Kammersystems erweitert, und da die
Röstung im englischen Ofen viel Brennmaterial erforderte, so wurde dieselbe von nun
an in kleinen Schachtöfen, sogenannten Kilns, welche aus
Nordengland entlehnt worden, ausgeführt und der alte Röstofen durch 4 Kilns ersetzt.
In diesen Kilns brennt das einmal in Brand gesetzte Erz nicht allein von selbst
fort, sondern es entzündet auch das frisch hinzugeworfene, so daß man kein
Brennmaterial mehr anzuwenden braucht, wenn der Ofen in Hitze gekommen und das Erz
entzündet ist.
Im Jahre 1854 wurde eine zweite Fabrik mit Kammern von größeren Dimensionen erbaut
und dabei auf eine demnächstige Erweiterung Bedacht genommen, die im Jahre 1858 dann
auch zur Ausführung gekommen ist.
Im Folgenden werde ich hauptsächlich das im Jahre 1854 erbaute Kammersystem (Fig. 1, iklm, nstu, vwxy) beschreiben, da dasselbe nach den neuesten
Grundsätzen erbaut, schon seit 4 Jahren im Betriebe ist, während das im Jahre 1858
erbaute größere (IKLM, NSTU, VWXY) erst seit dem
Anfange des Jahres 1859 in Betrieb gesetzt worden ist.
Kammerdimensionen und deren Inhalt.
Textabbildung Bd. 154, S. 182
Fabrikanlage vom Jahre; Anzahl der
Kilns; Kammern auf dem; Vorboden in Fußen; Hauptboden in Fußen; Boden in Fußen;
Summa Kubikinhalt jedes Systems; Summa; Kubikf.
Ofen und Ofenarbeiten.
Die zum Abrösten der Erze behufs der Schwefelsäurefabrication angewandten Kilns (Fig. 2–6) haben die
Gestalt einer umgekehrten abgestumpften Pyramide; a und
b sind Oeffnungen zum Ausziehen des gerösteten Erzes, f zum Einwerfen des frischen Erzes, c, d, e, i zum Durchrühren des Erzes, g Salpetercanäle und h
Canäle, in die man vorräthige Salpeterkasten stellt. Es sind dieß die Oefen der
alten Fabrik, welche der neuen Fabrik als Muster gedient haben, nur mit dem
Unterschiede, daß in der letztern nicht 4, sondern 8 Oefen zusammengelegt sind.
Dieselben sind aus Barnsteinen erbaut und mit eisernen Verankerungen versehen. Für
je 4 Oefen sind 2 Salpetercanäle vorhanden, welche so zwischen den Ofenschächten
liegen, daß die zur Zersetzung des Salpeters erforderliche Temperatur erreicht wird.
Die über dem Hauptgewölbe vereinigte Salpeter- und schweflige Säure ging bei
der ersten Anlage der Kilns durch eine Bleiröhre, die man fortwährend durch kaltes
Wasser abkühlte, in die Kammern, wo die schweflige Säure bei Gegenwart von
Wasserdampf in der Weise höher oxydirt wird, daß Stickstoffoxyd den Ueberträger des
Sauerstoffes spielt. Diese Bleiröhren wurden aber bald, vorzüglich durch die
Salpetersäure, zerstört, und man wendet daher in neuester Zeit gußeiserne Röhren f (Fig. 1) von 1 Zoll
Wandstärke und 18–20 Zoll lichtem Durchmesser an, da dieselben nach hier
gemachten Erfahrungen wenig von den durchgehenden Dämpfen angegriffen werden.
In diesen Röhren erzeugt sich schon, wahrscheinlich durch die Feuchtigkeit der
Atmosphäre, tropfbar flüssige Schwefelsäure bis zu 60° Baumé
concentrirt. Dieselbe ist von violetter Farbe, syrupartig und enthält bedeutende
Antheile Stickstoffoxyd. Für je 4 Oefen nimmt man 1 Röhrenstrang, welcher aus 3 oder
4 einzelnen Röhren, jede von 8 Fuß Länge, besteht; die einzelnen Röhrenstücke sind
durch Muffe verbunden und die Verbindungsstellen mit einem Gemenge aus Asbest und
Kalk gedichtet (in Fig. 1 mit f und F bezeichnet). Diese Eisenröhren sind an der obern Seite mit einer
verschließbaren Oeffnung versehen, um sie auf bequeme Weise reinigen zu können. Es
ist für die Kammern nicht gut, wenn die Kilns zu nahe an denselben liegen, weil die
Kammerwände dem schädlichen Einflusse der heißen Dämpfe dann mehr ausgesetzt
werden.
Hat man die Kilns neu erbaut, so wärmt man sie durch allmählich verstärktes
Holzfeuer, welches man auf der Ofensohle anbringt, einige Tage ab, bringt dann bis
auf 3'' unter der Thür f (Fig. 2, 5, 6) geröstetes Erz hinein,
und erhält auf diesem Erze so lange ein starkes Flammenfeuer, bis die Ofenwände,
vorzüglich das Gewölbe, rothglühend geworden sind. Ist dieser Zustand eingetreten,
so bringt man durch f etwa 3–4 Zoll hoch rohes
Erz in Wallnuß- bis Faustgröße auf das geröstete Erz. Das rohe Erz entzündet
sich durch die Ofenhitze und das Holzfeuer und röstet ab. Die Dämpfe leitet man so
lange ins Freie, als noch Holzfeuer vorhanden. Ist dieses abgebrannt und das Erz in
vollständiges Glühen
versetzt, so werden die Dämpfe den Kammern zugeführt. Man fährt nun in der Weise
fort, daß man unten so viel geröstetes Erz auszieht, als man oben rohes nachwirft.
Die Oefen werden in der Weise behandelt, daß man in 24 Stunden jeden dreimal
entleert und frisch besetzt und dreimal nachsieht; es werden alle 2 Stunden 2 Oefen
frisch besetzt und 2 andere nachgesehen. Das Nachsehen geschieht 4 Stunden nach dem
Besetzen und besteht in einem Durchbrechen des Erzes mittelst eiserner Stangen,
damit die Luft gehörigen Zutritt behält. Die zur Oxydation des Schwefels
erforderliche Luft tritt nämlich zum großen Theile durch das geröstete Erz von Unten
hinzu; die etwa fehlende wird durch die in den Seitenthüren befindlichen Schieber
zugeführt. Der Salpeter (jetzt Chili- oder Natronsalpeter wegen größern
Salpetersäuregehaltes) wird in gußeisernen Kästen mit Schwefelsäure von 60°
B. übergossen und in die Canäle g gestellt. Diese werden
nach Verlauf von 4 Stunden mit frischen Salpeterkästen versehen, so daß jeder Canal
in 24 Stunden sechsmal frisch besetzt wird. Bei dem Rösten hat man hauptsächlich
darauf zu sehen, daß das Feuer nicht nach Unten geht und so ein Zusammenschmelzen
der Masse verursacht. Man muß deßhalb das Erz nicht zu dicht auf einander bringen,
also nicht Erze von zu kleinem Korne nehmen. Es haben sich Stücke von 2–3
Zoll Größe als die zweckmäßigsten bewährt, denn dickere Stücke lassen zu viel Luft
durch und verursachen eine Abkühlung, feinere Erze sintern öfters zusammen. Außerdem
tritt durch feines Erz zu wenig Luft hinzu, um eine vollkommene Abröstung zu
bewirken.
In den 8 Oefen der Fabrik vom Jahre 1854 röstet man in 24 Stunden 12 Scherben Erz ab
und gebraucht in derselben Zeit 100 Pfd. 8 Loth Salpeter. Man nimmt auf jeden
Einsatz durchschnittlich 4 Pfd. 2 Loth Salpeter und übergießt denselben mit 3 Pfd.
19 Loth Schwefelsäure von 60°. Das dabei erfolgende schwefelsaure Natron
enthält:
38
NaO
61
SO³
1
HO
––––––––––––––
100.
Dampfkessel.
Der Dampfkessel A' (Fig. 1) ist von 1/2 Zoll
starkem Eisenblech angefertigt, 13 Fuß 4 Zoll lang und von 4 Fuß Durchmesser. Man
erhitzt ihn gewöhnlich bis zu 4 Atmosphären. Die abgehende Hitze erwärmt das Wasser
in einem Vorwärmkessel von Gußeisen, welcher mit dem Hauptkessel durch eine
Speisepumpe in Verbindung steht. Der Dampf wird in kupfernen Röhren von 2 Zoll Durchmesser nach den
Kammern geleitet; es dient derselbe auch zum Translociren der Eisenvitriollauge und
zum Erwärmen des Wassers. Die kleine oder Vorkammer hat 1, die Haupt- oder
große Kammer 3 und die Bodenkammer 1 Dampfspritze, welche in der halben Höhe der
Kammer den Dampf zuführen. Man verbrennt unter dem Dampfkessel in 24 Stunden
10–12 Balgen Steinkohlen à 2 1/2
Kubikfuß.
Kammern und Kammerarbeit.
Bei den hiesigen Fabriken hat sich ein System von einer kleinern Vorkammer, einer
Haupt- und einer Bodenkammer am besten bewährt.
Die Kammern befinden sich in einem gut verbundenen Holzgestell, welches aus 10 Zoll
im Quadrat haltenden Balken besteht; man setzt das Gestell aus Ständern, Riegeln,
Bändern und Schwellen zusammen.
Man bekleidet zuerst die Seitenständer mit Bleiplatten, von denen der Quadratfuß 6
Pfd. wiegt, und löthet sie mittelst Wasserstoff an den betreffenden Stellen
zusammen. Nachdem die Wände vollendet sind, bedeckt man den Boden und Deckel mit
Bleiplatten. Man löthet an die Bleiplatten (an der Außenseite der Kammer) mehrere
Bleistreifen (Halter) von 6 Zoll Breite und 12 Zoll Länge und befestigt dieselben
mit eisernen Nägeln an das Holzgestell. Die Deckenplatte wird ebenso mit Haltern an
Balken befestigt, die man oben über die Kammer legt. Nachdem Alles gehörig
zusammengelöthet ist, bringt man im Boden und Deckel Oeffnungen von 2 Fuß
Durchmesser an, um in die Kammer gelangen zu können; diese Oeffnungen verschließt
man mit einer darüber gestellten Bleikapsel, die durch Wasserverschluß gedichtet
wird, damit die Dämpfe nicht entweichen.
Die Hauptkammer wird durch 2 Fuß hohe Bodenleisten in 2, 3 oder 4 Abtheilungen
getheilt, um bei etwaigen Reparaturen im Boden nicht die ganze Kammer entleeren zu
müssen.
Das zum Löthen dienende Wasserstoffgas entwickelt man in 2 Fuß hohen, 1 1/2 Fuß im
Durchmesser haltenden bleiernen Gefäßen aus schlesischem Zink und verdünnter
Schwefelsäure, leitet das Gas durch eine bleierne Waschflasche in einen Gasometer,
aus dem es in Kautschukröhren, die vorn mit einem messingenen Hahne und einer feinen
Spitze (Löthrohr) versehen sind, dem Löther zugeführt wird. Man nimmt auf 5 Pfd.
Zink 12–14 Pfd. Schwefelsäure von 20° Baumé und setzt die
erhaltene Zinkvitriollauge in Juliushütte bei der Vitriolsiederei zu.
Die Hauptkammer steht mit der Vorkammer durch eine Bleiröhre a' und b' (Fig. 1) in Verbindung, die
gleichen Querschnitt mit den Eisenröhren
f hat. Von der großen Kammer führt ein stehendes
Bleirohr von 9'' Durchmesser die Dämpfe in die Bodenkammer; an diesem Rohre ist ein
Geschütz zur Regulirung des Zuges angebracht; aus der Bodenkammer führt ein Bleirohr
von 8'' innerem Durchmesser die Dämpfe ins Freie.
Um den Proceß in den Kammern beurtheilen zu können, befinden sich im Innern an der
einen langen Seite derselben Tische, die 3' über dem Boden eine Bleiplatte von 2'
Länge und 1 1/2 Breite tragen. Diese Platte reicht bis an die Wand und es sammelt
sich auf ihr Säure an, die sich durch eine Bleiröhre in ein außerhalb der Kammer
befindliches Becherglas ergießt, wo man ihre Grädigkeit ermitteln kann. Die
Vorkammer und Bodenkammer haben jede 1, die Hauptkammer 2 oder 3 Tische (gewöhnlich
so viel Tische als Abtheilungen). Um die Säure aus den Kammern abzulassen, befinden
sich am Boden derselben, welcher nach dieser Seite etwa 3'' Fall hat, bleierne
Röhren, von denen jede in einen bleiernen Topf von 1' Höhe und 1' Durchmesser
mündet, und kann in diesen Töpfen zugleich der Säurestand in der Kammer beobachtet
werden. Bei den im Jahre 1858 erbauten Kammern sind statt der Bleitöpfe Nischen in
der Kammerwand unter den Tischen angebracht. Die Säure aus der Bodenkammer läßt man
in die Hauptkammer fließen.
Hat man ein Kammersystem neu erbaut, so prüft man die Kammern, ob sie im Boden dicht
sind, dadurch, daß man sie 6'' hoch mit Schwefelsäure anfüllt. Hat sich die Kammer
als dicht erwiesen, so läßt man, um die Atmosphäre herauszutreiben, einige Tage nur
schweflige Säure vom Rösten der Erze hindurchgehen. Man nimmt alsdann anfangs nur
wenig Salpeter und Wasserdampf und legt mit denselben so lange allmählich zu, bis
die Kammerwände milchwarm geworden sind und man am Säurestande eine Vermehrung
bemerkt. Man hat bei den Kammern Folgendes zu beobachten:
1. Die Kammerwände müssen milchwarm seyn.
Erfahrungsmäßig geht bei dieser Temperatur der Proceß am zweckmäßigsten vor sich.
Werden die Kammern zu warm, so nimmt man weniger Salpeter; werden sie zu kalt, so
setzt man mehr Salpeter ein.
2. Die Dämpfe, die aus der Bodenkammer entweichen, dürfen nicht
röthlich erscheinen.
Es ist dieß ein Zeichen, daß überschüssige Salpetersäure in den Kammern vorhanden
ist, man bricht deßhalb an Salpeter ab.
3. Die Säure muß
in
der
Vorkammer
50–52°
Baumé
„
„
Hauptkammer
48–50°
B.
„
„
Bodenkammer
47–48°
B. stark seyn.
Wird die Kammer- oder Rohsäure stärker, so absorbirt sie Stickstoffoxyd und
entzieht es auf diese Weise dem Processe; ohnehin ist zur spätern Reinigung der
Säure eine geringe Grädigkeit erforderlich. Wird die Rohsäure schwächer, so läßt man
weniger Wasserdampf hinzutreten; wird die Säure zu stark, so läßt man so lange mehr
Dampf einströmen, bis dieselbe die gehörige Stärke wieder hat. Die Säure nimmt in 24
Stunden in der Vor- und Hauptkammer um 1/4–1/2'', in der Bodenkammer
um 1/8–1/4'' zu.
4. Bei ruhigem Wetter wird das Geschütz höher geöffnet, während man es bei Sturm und Wind etwas schließt, um die Gase nicht zu rasch durchgehen zu
lassen.
5. Nimmt die Säure in den Kammern nicht zu, so ist dieses
ein Beweis, daß zu viel Luft mit in dieselben gedrungen ist, und öffnet man in
diesem Falle die Deckel der Kammern etwas, um durch schweflige Säure die Luft wieder
auszutreiben. Daß in solchen Fällen das Einsetzen des Salpeters unterbleibt, bedarf
wohl kaum der Erwähnung. Die zum Dache Hinausgehenden Dämpfe enthalten noch viel
Stickstoffoxyd, und da dieses für den Proceß verloren geht, so hat man vor einigen
Jahren Versuche angestellt, das Stickstoffoxyd zu
gewinnen und für den Proceß wieder nutzbar zu machen. Man leitete die
Dämpfe aus der Bodenkammer durch einen neben dieser befindlichen Canal aus
Bleiplatten. Derselbe war 155' lang, 1 1/2' breit, 3/4' hoch und 1/2' hoch mit
Schwefelsäure von 63° Baumé angefüllt. Diese hat die Eigenschaft,
Stickstoffoxyd aufzunehmen und bei geringerer Grädigkeit wieder auszustoßen. Die mit
Stickstoffoxyd geschwängerte Säure wurde in die erste Abtheilung der Hauptkammer
abgelassen, wo das Stickstoffoxyd austrat und wieder dienstbar wurde. Es stellte
sich aber bei diesem Apparate der Uebelstand ein, daß die Säure durch den mit
hindurchgehenden Wasserdampf auf ihrer Oberfläche verdünnt und ihre
Absorptionsfähigkeit dadurch geschwächt wurde. Außerdem verursachten der Transport
und die spätern Concentrationsarbeiten der Säure so bedeutende Kosten, daß dadurch
der Werth des ersparten Salpeters nicht aufgewogen wurde. Aus diesem Grunde warf man
diesen Apparat wieder weg; man denkt aber durch einen sogenannten Gay-Lussac'schen Apparat diesen Uebelständen
abzuhelfen, indem man die Dämpfe durch einen stehenden Bleicylinder leiten wird, der
mit durch Schwefelsäure befeuchteten Kohksstücken angefüllt ist.
Um bei der Schwefelsäurefabrication den Salpeter ganz zu beseitigen, ist vor 3 Jahren
das von Wöhler in Vorschlag gebrachte Verfahren, die
schwefligsauren Dämpfe über feinzertheilte, glühende Oxyde zu leiten, auch hier
versucht worden. Obgleich eine Schwefelsäureerzeugung vor sich ging, so war der dazu erforderliche
Zeitaufwand zu bedeutend, als daß von dieser Methode im Großen irgend ein Nutzen
erwartet werden konnte.
Am Boden der Kammern, besonders der Vorkammer, setzt sich Selenschlamm ab, der periodisch daraus entfernt, getrocknet und das Pfund
zu 5 Ngr. verkauft wird.
Die gewonnene Säure enthält sehr geringe Antheile schweflige Säure, Selen, arsenige
Säure und Stickstoffoxyd. Um sie von diesen Stoffen zu befreien, unterwirft man die
Säure einer Reinigung.
Reinigung der Säure.
Zu diesem Zwecke läßt man die Kammersäure in bleierne Fällpfannen p (Fig. 1), von 10' Länge, 5'
Breite und 2' 8'' Tiefe ab und verdünnt sie bis 46° Baumé.
Die Pfanne wird mit einem Bleideckel, der durch Wasserverschluß verdichtet ist,
versehen und die Säure bis 60° R. allmählich erhitzt, worauf man so lange Schwefelwasserstoffgas in dieselbe leitet, bis sie
milchig von sich ausscheidendem Schwefel erscheint. Das Schwefelwasserstoffgas
entwickelt man aus Schwefeleisen, welches mit Schwefelsäure von 30° B.
übergossen wird, und zwar braucht man zu 10 Pfund Schwefeleisen 35 Pfund durch Dampf
erhitztes Wasser und 30 Pfund Säure aus der Vorkammer, welche bei schlechterer
Beschaffenheit als die Säure aus der Haupt- und Bodenkammer zu diesem Zwecke
gut genug ist. Die Gasentwickelungsapparate, Maschinen g
(Fig. 1),
deren 4 zu einer Pfanne vorhanden, sind bleierne Cylinder, 2 3/4' hoch und haben bei
2' Durchmesser oben eine durch Verschmutzung dicht verschließbare Oeffnung zum
Einbringen des Schwefeleisens und der Säure, und unten am Boden eine Röhre zum
Ablassen der Eisenvitriollauge. Aus jeder Maschine geht oben eine bleierne Gasröhre
in die Fällpfanne, wo sie am Boden derselben in ein Bleiröhrenviereck (Rahmen)
endigt, das an vielen Stellen durchbohrt ist, um das Gas nach allen Seiten hin
ausströmen zu lassen. Das überschüssige Gas entweicht durch ein Bleirohr aus dem
Pfannendeckel in einen 141' hohen Schlot, oder man steckt es an, damit es der
Umgebung nicht zur Last fällt. Die rein ausgefällte Säure läßt man 6 Stunden lang
sich klären und führt sie darauf durch einen Heber dem Säurereservoir e (Fig. 1) zu, um sich hier
noch vollends zu klären und für die weitere Concentration anzusammeln. Vom Bodensatz
trennt man die Säure durch die bleierne Filtrirvorrichtung q (Fig.
1), bestehend aus 4 doppelbödigen Sieben, zwischen denen Asbest liegt.
Die Darstellung des Schwefeleisens behufs Erzeugung von
Schwefelwasserstoffgas geschieht in einem kleinen Zugofen, auf dessen Rost ein 300 märkiger
Graphittiegel von 13'' oberm, 7'' unterm Durchmesser und 21'' Höhe steht; im Boden
hat derselbe ein 3'' weites Loch. Der Tiegel wird völlig mit altem Schmiedeeisen
angefüllt und mit Kohks und Holzkohlen so lange erhitzt, bis das Eisen weißglühend
geworden ist, worauf man oben auf dasselbe von Zeit zu Zeit gepulverten Schwefel
wirft. Dieser verbindet sich mit dem Eisen zu Schwefeleisen, welches durch das
Tiegelloch in eine eiserne Pfanne fließt. Man gibt so lange Schwefel nach, bis alles
Eisen in Schwefeleisen verwandelt ist, worauf man den Tiegel nach vorheriger
Reinigung wieder mit Eisen anfüllt. Das entstehende Schwefeleisen wird vor seiner
Anwendung in Wallnußgröße zerschlagen und soll nach einer in Dr. Mohr's Titrirmethode angegebenen Analyse
27,16 Proc. S
69,76 Proc. Fe enthalten.
Die bei der Schwefelwasserstoffdarstellung als Nebenproduct erhaltene Eisenvitriollauge wird aus den Maschinen in einen mit
Blei ausgeschlagenen Kasten abgelassen, aus dem sie der bleiernen Siedepfanne o (Fig. 1) zufließt. Diese
ist 8' 6'' lang, 7' breit und 2' 3'' tief. Die zu versiedende Lauge enthält viel
freie Säure und es wird ihr deßhalb zur Neutralisirung Eisen in der Pfanne
zugesetzt. Man muß nämlich zu dem Schwefeleisen überschüssige Säure gießen, um es
vollständig auszunutzen. Man siedet die Vitriollauge so lange, bis sie 40°
Baumé hat, worauf sie nach vorheriger Abkühlung und Klärung in einen der 6
Krystallisirkästen abgelassen wird, welche 3' 6'' hoch, 5' breit, 5' lang und mit
Blei ausgeschlagen sind. An den Wänden, sowie an 20 in die Lauge gehängten
Bleistreifen sehen sich die Krystalle innerhalb 14 Tagen bis 3 Wochen an, worauf man
die Mutterlauge in ein im Baugrunde befindliches Druckfaß von 6' Höhe und 3 1/2'
Durchmesser abläßt, aus dem sie mittelst Dampfdrucks durch ein 4'' dickes bleiernes
Steigrohr in die Pfanne gedrückt wird, um dort mit Rohlauge wieder versotten zu
werden. Die Krystalle werden von den Bleistreifen und Wänden losgehauen, auf eine
Bühne gebracht, woselbst sie bis zur Trockne aufbewahrt und dann in Fässer von 4 bis
5 Ctr. Inhalt verpackt werden; der Bodensatz aus den Kästen wird beim Sieden wieder
zugesetzt. Ein Sud dauert 24 bis 36 Stunden und producirt man mit 6 Balgen
Steinkohlen (à 2 1/2 Kubikfuß) 20–30 Ctr.
verkäuflichen Vitriol.
Concentration der Säure in Bleipfannen auf 60°
Baumé.
Das für die gereinigte Säure vorhandene Reservoir e ist
20' lang, eben so breit und 2' tief; eine Bleiröhre mit einem Glashahne führt 2''
vom Boden die Säure aus dem Reservoir den bleiernen Concentrationspfannen (a, b, c, d) von 18'' Tiefe zu. Jede folgende Pfanne liegt 2'' tiefer als
die vorhergehende. Es sind 2 Feuerungen vorhanden, unter a und c; vor d
liegt der Platinkessel z, der eine besondere Feuerung
hat, welche zugleich für die Pfanne d benutzt wird. Alle
Pfannen sind durch Bleiröhren mit Hähnen und durch Heber in Verbindung gesetzt.
Der Zufluß der Säure aus dem Reservoir wird in der Weise regulirt, daß in der Pfanne
a Säure von 48°, in b solche von 54° und in c solche von
60° Baumé entsteht.
Von hier tritt sie in die Pfanne d zur Kühlung und läuft
aus dieser durch eine Bleiröhre, die mit einem Hahne versehen ist, durch den nicht
erwärmten Platinkessel, dessen Heber und Kühlvorrichtung in gläserne Ballons. Man
producirt in 24 Stunden mit 12 Balgen Steinkohlen 54 bis 60 Ctr. Säure von
60° Baumé. Die 15'' tiefe Pfanne c dient
zur Concentration von Kammersäure auf 60° und findet diese Säure ihre
Anwendung bei der Zersetzung des Salpeters.
Concentration im Platinkessel auf 66° Baumé.
Soll die 60grädige Säure bis auf 66° concentrirt werden, so bedient man sich
eines Platinkessels, da die Bleipfannen eine höhere Concentration als 60°
wegen ihrer Leichtschmelzbarkeit und Auflösbarkeit nicht zulassen. Der jetzt im
Betriebe befindliche Platinapparat z ist in Paris von
Desmoutis, Morin und Chapuis angefertigt. Er hat 280 Liter Inhalt, wiegt 42 Kilogramme und
kostete pp. 14000 Thlr.
Dem mit einem Helme versehenen Kessel wird die 60grädige Säure aus d durch eine Bleiröhre mit einer Hahnvorrichtung
zugeführt und hier bis 66° concentrirt. Als Zeichen für den Eintritt dieser
Grädigkeit dient theils ein Platinschwimmer, theils gibt die Stärke der aus dem Helm
in ein Bleirohr übergehenden condensirten Dämpfe, wenn die Säure eine Stärke von
20° Baumé erreicht hat, den Wink zum Ablassen der Säure aus dem
Kessel. Früher geschah die Feuerung des Platinkessels mit Steinkohlen; da man jedoch
die Erfahrung machte, daß durch das Steinkohlenfeuer der dem Fuchse zugekehrte und
vom Säurestande nicht erreichte Theil des Platinkessels öfters beschädigt worden
war, was einem Schwefelkiesgehalte der Kohlen zuzuschreiben seyn möchte, so feuert
man seit jener Zeit mit Holz. Das Ablassen der concentrirten Säure geschieht
mittelst eines aus Platin angefertigten Hebers, der bis auf 2'' über dem Boden des
Kessels reicht, 3' vom Kessel entfernt sich in 2 Röhren aus Platin theilt, die von
einem kupfernen Kühlrohr umschlossen sind, durch welches beständig kaltes Wasser
fließt. Am Ende des Hebers befindet sich ein Platinhahn, der die Säure zur weitern
Abkühlung einer 50' langen, 1 1/2'' weiten, im Wasser liegenden Bleischlangen zuführt, um sich
aus dieser in die Ballons zu ergießen. Im Kessel pflegt etwa ein halber Ballon Säure
zurückzubleiben; zu diesem wird aufs Neue die zu einem Ballon erforderliche
60grädige Säure aus d gezapft. Die aus verdichteten
Dämpfen erzeugte Säure von durchschnittlich 15° Baumé wird
hauptsächlich zur Erzeugung von Kupfervitriol benutzt. Man producirt in 24 Stunden
mit 1 1/2 Schock Waasen etwa 46 Ctr. Säure von 66° Baumé.
Die zur Aufnahme der Schwefelsäure dienenden gläsernen Ballons wiegen jeder etwa 15
Pfund und können 200 Pfund concentrirte Säure aufnehmen. Sie werden in Weidenkörben
mit Stroh verpackt, mit einem in flüssigen Schwefel getauchten Pfropfen von
gebranntem Thon verschlossen, dieser mit Thon überkleidet und mit einem leinenen
Lappen überbunden. Der Korb wird mit einer hölzernen Marke versehen, auf welcher
außer dem Brutto-, Tara- und Nettogewichte auch der Grad der Säure
angegeben ist, und so in den Handel gebracht.
Arbeiterzahl, Production und Materialverbrauch.
Im Jahre 1857 sind in 16 Oefen durch 17 Arbeiter aus 7184 Scherben oder ca. 32000 Ctr. Kupferkies haltigem Schwefelkiese 28500
Ctr. Rohsäure von 48° (oder 17100 Ctr. auf 66° reducirt) dargestellt,
aus der, nachdem davon 2620 Centner 85 Pfd. zum Verkauf und zum Verbrauch im
Betriebe entnommen, 3283 Ctr. 44 Pfund 60grädige und 11195 Ctr. 92 Pfd. 66grädige
Säure durch Concentration erhalten sind.
Außerdem wurden producirt:
2536
Ctr. Eisenvitriol,
696
Ctr. schwefelsaures Natron,
56
Pfund Selenschlamm.
Hierzu sind verwendet:
824
Ctr. Chilisalpeter,
613
Ctr. Eisen,
8334
Balgen Steinkohlen à 2 1/2
Kubikfuß;
52
Malter Holz à 80 Kubikfuß,
269
Balgen Kohks,
10
Maaß (à 10 Kubikfuß) Holzkohlen,
241
Schock Waasen,
150
Ctr. Schwefel.
Hiernach werden aus 1 Scherben oder ca. 4 1/2 Ctr. Erz
etwa 2 Ctr. auf 66° reducirte Säure dargestellt, und da im Jahre 1857 16
Kilns mit pp. 55000 Kubikfuß Kammerraum im Betriebe
waren, so ist zur Darstellung von 1 Ctr. 66° Säure im Jahre pp.
3,24 Kubikfuß Kammerraum nöthig gewesen.
Das in den hiesigen Fabriken zur Anwendung kommende Erz besteht im Wesentlichen aus
etwa 20 Proc. Kupferkies und 80 Proc. Schwefelkies. Es enthält gegen 50 Proc.
Schwefel, von dem zeither in freien Haufen bei der ersten Röstung nur 1/2 Pfund oder
1 Proc. in Substanz gewonnen wurde; wenn nun durch die Behandlung dieser Erze auf
Schwefelsäure von 1 Scherben oder ca. 4 1/2 Ctr. Erz 2
Ctr. 66grädige Säure erfolgt sind, so werden von obigen 50 Pfd. Schwefel 15 Pfd.
oder 30 Proc. als Schwefelsäure ausgebracht.
Tafeln