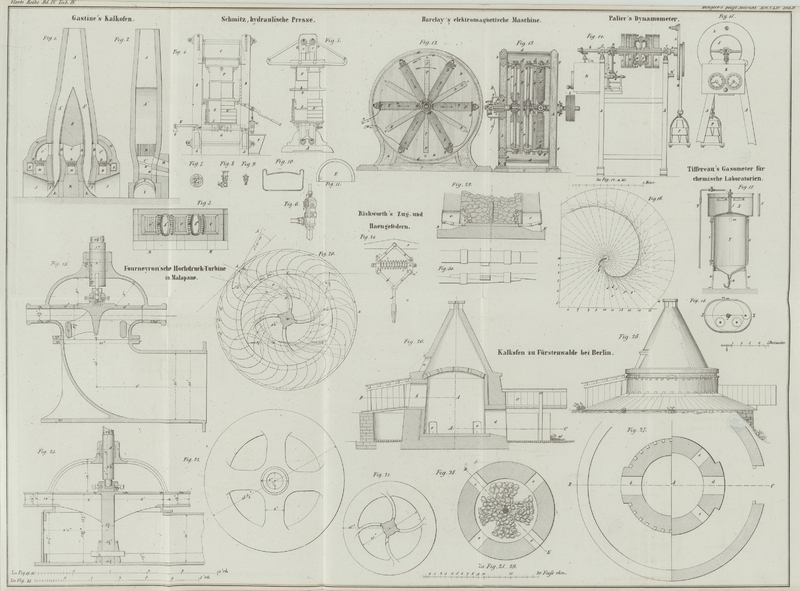| Titel: | Ueber Tiffereau's Apparat zum Aufsammeln, Messen und Umfüllen der Gase in chemischen Laboratorien; Bericht von Gaultier de Claubry. |
| Fundstelle: | Band 154, Jahrgang 1859, Nr. LVII., S. 260 |
| Download: | XML |
LVII.
Ueber Tiffereau's Apparat zum Aufsammeln, Messen und
Umfüllen der Gase in chemischen Laboratorien; Bericht von Gaultier de Claubry.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, Juli 1859, S. 401.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Tiffereau's Apparat zum Aufsammeln, Messen und Umfüllen der Gase in
chemischen Laboratorien.
Wenn man täglich in den Laboratorien die Chemiker mit so großer Leichtigkeit Gase
aller Art aus Gefäßen von allen Formen und Rauminhalten in andere Gefäße umfüllen
steht, so möchte man sich wundern, daß einer der ausgezeichnetsten Repräsentanten
der Wissenschaft, Priestley, im letzten Jahrhundert als
Anleitung zu den heut zu Tage so einfachen Manipulationen ein eigenes Werk
veröffentlicht hat. Die Sache erscheint jedoch ganz natürlich, wenn man bedenkt, daß
die Gase dazumal erst eine Stelle in der Wissenschaft einzunehmen ansingen, und daß
zur Unterweisung in den mit denselben vorzunehmenden Manipulationen die
Geschicklichkeit eines Chemikers ersten Ranges erforderlich war. Jetzt ist es, wie
erwähnt, sehr leicht, dieselben auszuführen, und in sehr vielen Fällen, wenn es sich
um Gase handelt, die im Wasser unlöslich oder nur wenig löslich sind, reicht eine
einfache Schüssel und eine durchbohrte Scherbe für die Mehrzahl der Operationen
hin.
Handelt es sich aber darum, große Quantitäten von Gas zu sammeln und aus Behältern,
in denen man sie aushängt, in andere überzuführen, oder kommt es, wie bei vielen
Versuchen darauf an, bedeutende Luft- oder Gasmengen herbeizusaugen, indem
man sie zum Behuf ihrer Reinigung oder Trocknung durch verschiedene Flüssigkeiten
oder feste Körper streichen läßt, so ist man genöthigt, die zur Erfüllung dieser
verschiedenen Bedingungen nöthigen Apparate zu vervielfältigen.
William Henry beschrieb meines Wissens zuerst im Jahre
1812 in seinem Handbuch der Experimentalchemie unter dem Namen Gasometer (gas holder) einen Apparat, welcher
die Bestimmung hat, größere Gasmengen zu sammeln. Einige Modificationen abgerechnet,
z.B. die Hinzufügung einer Wasserstandsröhre, um das Gasvolumen annähernd zu
ermitteln, findet man den Henry'schen Apparat noch jetzt
überall in den Laboratorien in Gebrauch.
Hr. Tiffereau hat in einem
einzigen Instrumente Alles zu vereinigen gesucht, was bei den Manipulationen mit
Gasen nothwendig erscheint, nämlich: einen graduirten Cylinder, um das Gasvolumen
mit der hierbei möglichen Genauigkeit zu messen, einen Aspirator und eine
pneumatische Wanne. Diesen Zweck hat er durch ganz einfache und sinnreiche
Anordnungen erreicht. Ein cylindrischer Behälter aus Zink trägt eine pneumatische
Wanne, und steht mit dieser durch eine mit einem Hahn verschließbare Röhre, welche
ihm das Gas zuführt, in Verbindung. An seinem unteren conischen Ende befindet sich
eine gleichfalls mit Hahn versehene gekrümmte Röhre zum Ablassen des Wassers. Eine
andere Röhre setzt den unteren Theil der Wanne mit demjenigen des Behälters in
Verbindung. Auf der entgegengesetzten Seite ist eine Wasserstandsröhre befestigt.
Eine mittelst eines Schraubenstöpsels verschließbare Oeffnung gestattet ein
Thermometer in den Behälter zu bringen.
Nachdem man den Behälter mit Wasser gefüllt hat, setzt man den Gasentbindungsapparat
mit dem oberen Hahn in Verbindung, und öffnet den Hahn, welcher mit dem Boden des
Cylinders communicirt, worauf sich der Behälter mit Gas füllt.
Will man nun das Gas in kleine Glocken, Cylinder oder andere auf die Brücke der
pneumatischen Wanne gestellte Gefäße füllen, so schließt man den unteren Hahn, und
öffnet den Hahn des Gasentbindungsrohres und denjenigen der mittleren Röhre,
mittelst welcher das Wasser der Wanne die Stelle des Gases einnimmt. Für Versuche
mit dem Löthrohr schraubt man dieses auf die Entbindungsröhre.
Will man den Apparat als Aspirator gebrauchen, so schraubt man den Hahn, welcher zur
Einführung des Wassers dient, ab, und erseht ihn durch eine Röhre, welche sich bis
zu einem Abstand von ungefähr 1 Centim. vom Boden des Behälters abwärts erstreckt,
und die man mit der äußeren Luft in Communication setzt, wenn man mit
atmosphärischer Luft arbeitet, hingegen mit Wasch- oder Trockenapparaten,
wenn man getrocknete Luft oder verschiedene Gase anzuwenden hat, und öffnet die
geeigneten Hähne. Die Luft oder die Gase dringen alsdann in den Behälter, welcher,
wie das Mariotte'sche Gefäß, einen constanten Ausfluß
gewährt.
Die in Wasser auflöslichen Gase werden mit Ausnahme des Chlorgases, welches das
Quecksilber angreift und des Jodwasserstoffgases, welches in Berührung mit demselben
sich zersetzt, sämmtlich über Quecksilber aufgefangen. Man kann jedoch zum
Aufsammeln einiger in Wasser ziemlich löslichen Gase, wie der Kohlensäure und des
Schwefelwasserstoffs, sich mit Vortheil des Wassers bedienen, indem man eine
gesättigte Auflösung von schwefelsaurer Magnesia anwendet, welche ich schon vor
langer Zeit hierzu
empfohlen habe.Annales de Chimie et de Physique, t. XXXVII p. 380. Schüttelt man nämlich die beiden erwähnten Gase fünf Minuten lang lebhaft
mit verschiedenen gesättigten Salzlösungen, so erhält man folgende Resultate:
Kohlensäure.
Schwefelwasserstoff.
Wasser
100
80
92
Auflösung von schwefelsaurem Natron
100
80
91
„ „
salpetersaurem Kali
100
74
92
„ „
schwefelsaurer Magnesia
100
20
52
Man kann sich demnach des Tiffereau'schen Apparates für
viele Operationen des Laboratoriums mit Vortheil bedienen. Derselbe ist seit einigen
Jahren in mehreren Laboratorien zu Paris, namentlich in demjenigen des Prof.
Pelouze in Gebrauch.
Beschreibung des Apparates. – Fig. 17 ist ein
Verticaldurchschnitt des Apparates durch seine Achse, und Fig. 18 ein Grundriß
desselben.
X ist die pneumatische Wanne.
Y ist ein cylindrischer Behälter, welcher zur Aufnahme
der Gase dient und mit der Wanne X ein Ganzes bildet;
sein Boden ist kegelförmig und die Spitze des Kegels mit einem Hahn h und einer gekrümmten Röhre versehen.
j ist die Centralröhre, welche sich in der Achse der
Wanne erhebt und in den Behälter Y einmündet. Diese
Röhre endigt in einen Hahn, der nach Belieben abgeschraubt werden kann.
k ist eine Metallröhre, die an ihrem oberen Ende mit
einem Hahn versehen ist, und den Boden der Wanne mit dem des Behälters in Verbindung
setzt.
l ist eine gläserne Wasserstandsröhre, welche oben und
unten mit dem Behälter communicirt.
m ist ein Schraubenstöpsel, welcher eine Oeffnung
schließt, durch die man ein Thermometer in den Behälter einführen kann.
W ist ein Dreifuß, auf dem der ganze Apparat ruht.
Um den Behälter mit Gas zu füllen, füllt man ihn erst mit Wasser, setzt dann den
Gasentbindungsapparat mit dem Hahn der Röhre j in
Verbindung, und öffnet diesen Hahn (während der Hahn k
geschlossen ist) und eben so den Hahn h. In dem Maaße
als das Wasser abfließt, dringt das Gas in den Apparat.
Handelt es sich darum, aus dem Behälter Gas in einen auf die Brücke der pneumatischen
Wanne gestellten Glascylinder zu füllen, so öffnet man, während der Hahn h
geschlossen ist, den Hahn der Röhre j und den der Röhre
k, worauf das Wasser aus der Wanne in den Behälter
dringt, wo es die Stelle des Gases einnimmt.
Um Löthrohrversuche zu machen, schraubt man auf die Röhre j das Löthrohr selbst, und sammelt das Gas wie vorher auf.
S ist eine Röhr (tube à
flotteur) von der Höhe der Wanne, welche man auf das obere Ende der Röhre
k schraubt, wenn man eine regelmäßige Gasausströmung
wünscht.
T ist die Röhre, deren man sich bedient, wenn man den
Apparat als Aspirator gebrauchen will; nach Abnahme des Hahns von der Röhr j, steckt man in diese Röhre die Röhre T von kleinerem Durchmesser, deren größerer Schenkel bis
zu einem Centimeter Abstand vom Boden des Behälters reicht und oben einen Kork
enthält.
Tafeln