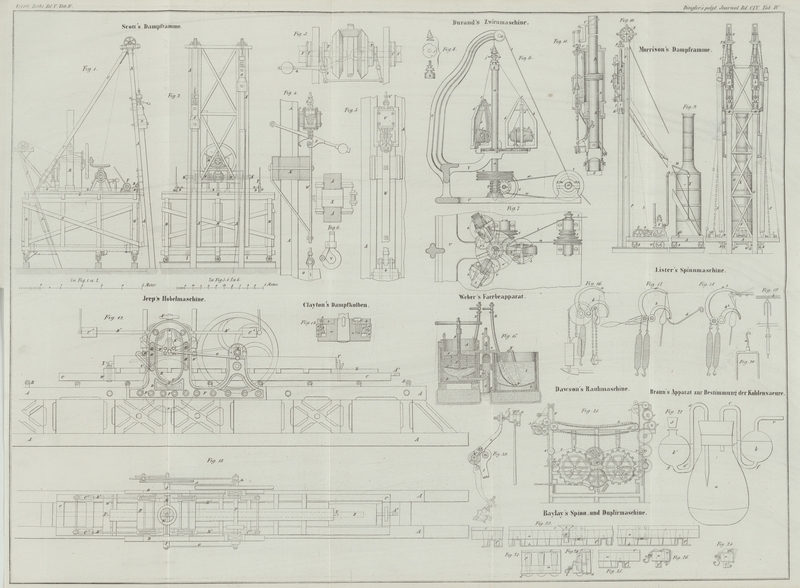| Titel: | Dampframme von Michael Scott und Andrew Robertson. |
| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LXXIII., S. 244 |
| Download: | XML |
LXXIII.
Dampframme von Michael Scott und Andrew Robertson.
Aus der Revue universelle des mines, August und September
1859, S. 121.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Scott's Dampframme.
Diese Ramme wurde beim Bau eines Ausladeplatzes am Flusse Blyth angewendet. Eine
Reihe von Pfählen, 2,44 Met. von Mittel zu Mittel entfernt, sollte auf eine Tiefe
von 4,42 Met. in einer Neigung von 1/12 in den Boden gerammt werden. Hinter dieser
ersten Linie, in 4,57 Met. Abstand, sollte eine zweite Reihe von Pfählen, ebenfalls
2,44 Met. von Mittel zu Mittel entfernt, in einer Neigung von 4/12 eingerammt
werden. Jeder Pfahl der zweiten Linie war in den Zwischenraum zu setzen, welchen
zwei Pfähle der ersten Linie bildeten, mit denen er durch Zugbalken verbunden wurde. Die Zwischenräume
der Pfähle der ersten Linie mußten durch Spunddielen von 0,305 Met. Breite auf 0,15
Met. Dicke und 3,05 bis 3,35 Met. Länge ausgefüllt werden. Mit Ausnahme eines
Theiles der Linie, welcher auf eine sehr feste Kiesbank traf, war der Grund sandig
und bot dem Eindringen der Pfähle große Schwierigkeiten dar. Das Terrain befand sich
0,60 bis 0,70 Met. über dem Niederwasser (Ebbe) der gewöhnlichen Frühlingsfluth,
welche zu Blyth eine Höhe von ungefähr 3,96 Met. erreicht.
Die Ramme, welche zur Anlage dieser Arbeiten benutzt wurde, ist in Fig. 1 in der
Seitenansicht und in Fig. 2 in der Vorderansicht dargestellt. Sie ist so eingerichtet, daß sie
zu gleicher Zeit zwei Pfähle der ersten Linie und einen der zweiten einschlagen
kann. Der Vordertheil der Ramme enthält zwei Laufruthen-Paare A, A, welche unter einander, in der für das Einschlagen
zweier Pfähle erforderlichen Entfernung, verbunden sind. Diese Laufruthen drehen
sich um Scharniere B, um ihnen die nothwendige Neigung
geben zu können, und werden durch Streben C gestützt.
Der gezimmerte Boden D, an welchem die Scharniere und
die Streben befestigt sind, ist von der Plattform E, auf
der er ruht, unabhängig und kann vorgerückt oder zurückgeschoben werden, je nachdem
es die Richtung der Laufruthen erheischt. Während des Rammens wird er aber durch
Bolzen auf der Plattform festgehalten. Seine Verschiebung auf derselben geschieht
mittelst der zu beiden Seiten angebrachten Räder F.
Unter diesen Rädern werden sehr scharfe eiserne Keile angebracht, und es genügt die
Räder zu drehen, um den gezimmerten Boden zu heben und ihn nach Bedarf vor-
oder zurückzuschieben. Die Keile werden dann durch einen Schlag mit dem Hammer
weggenommen.
Das gezimmerte Gerüst H, auf welchem die Plattform über
der hohen Fluth steht, ist durch Andreaskreuze fest verbunden und wird auf einer auf
dem Erdboden hergestellten Schienenbahn transportirt. Seine Versetzung geschieht
mittelst Ketten, welche an Ankern befestigt sind, die stromauf- und abwärts
auf den Grund des Wassers hinabgelassen wurden. Die Ketten gehen über die unten am
Gerüst befestigten Rollen I und dann über die äußere
Trommel K der Treibwellen. Ist die Maschine auf dem
Platze angelangt, so werden diese Ketten von den Trommeln abgenommen und an der
Plattform befestigt oder aufgehängt. Die Laufruthen L,
welche sich am Hintertheile der Maschine zum Einrammen der zweiten Pfahlreihe
befinden, werden unter dem erforderlichen Winkel befestigt, sind aber nicht
beweglich, weil sie nicht ganz genau gestellt zu werden brauchen.
Auf der Plattform E steht eine Dampfmaschine M mit zwei Wellen N, N, von
denen jede einen Rammklotz O in Betrieb setzt. Diese
Wellen sind mit
Kuppelungen und Bremsen versehen. Die Kuppelungen P, P
(Fig. 3)
sind so angeordnet, daß immer eine der Wellen eingerückt ist, während die andere
ausgelöst ist; das Aus- und Einrücken geschieht mittelst des Gewichthebels
Q, der sich frei auf seiner Achse dreht, und, indem
er in den Einschnitt R tritt, seine Wirkung ausübt.
Der Apparat wird folgendermaßen betrieben:
Nachdem die erste Welle durch das Gewicht des Hebels Q
eingerückt worden ist, wird der Rammklotz gehoben; während dieser Zeit dreht man den
Hebel in die durch punktirte Striche angezeigte Stellung; in dieser neuen Lage
strebt der Hebel die Kuppelung der Welle auszulösen, aber die Reibung welche beim
Heben des Rammklotzes erzeugt wird, verhindert die Auslösung; nachdem jedoch der
Klotz am Ende seines Hubes angelangt und von seiner Befestigung befreit ist, gibt
die Kuppelung dem Hebel nach und der Fallblock, welcher den ersten Klotz hielt,
fällt zurück, wobei die Geschwindigkeit seines Falles durch die angelegte Bremse T gemäßigt wird. Sobald die erste Welle ausgelöst ist,
kommt die zweite in Wirksamkeit, um den anderen Rammklotz zu heben, und die
Dampfmaschine arbeitet daher continuirlich, ohne Zeitverlust, fort.
Die anfangs angewendeten Bremsen und Kuppelungen gaben keine befriedigenden
Resultate. Diese Bremsen waren aus einem Stück mit den Kuppelungen, von welchen man
sie dann trennte, um sie auf den Wellen zu befestigen. Die Kuppelungen, deren
Reibungsflächen cylindrisch waren, boten dem Hebel einen zu großen Widerstand dar,
welchen man bedeutend verminderte, indem man ihnen eine schwach conische Form
gab.
Jeder Rammklotz O wog 1525 Kilogr.; beim Beginn seiner
Bewegung mußte ein so schwerer Rammklotz, in Folge der großen Geschwindigkeit womit
die Wellen sich drehten, die Wirkung eines Stoßes hervorbringen, welchem die Ketten
und das gezimmerte Gerüst auf die Dauer nicht widerstehen konnten. Um diese Wirkung
abzuschwächen, sah man sich also genöthigt eine Feder anzubringen. Die angenommene
Einrichtung, Fig.
4, besteht in einem Cylinder U, welcher mit
einem Kolben versehen ist, auf dessen obere Fläche eine starke gewundene Feder
drückt, deren Zusammenpressung ein Gewicht gleich demjenigen des Rammklotzes
erfordert. Der Kolbenschub ist 0,10 Met., und die Kette rollt sich um diese Länge
auf, ehe der Rammklotz zu steigen anfängt. Die Feder bleibt zusammengepreßt, so
lange als der Rammklotz steigt, und dehnt sich erst aus, wenn derselbe am oberen
Ende seines Weges angekommen und von seiner Befestigung losgemacht ist. Damit diese
Ausdehnung der Feder den Kolben nicht zu heftig gegen den Boden des Cylinders stoßen
kann, brachte man in diesem Boden eine kleine Oeffnung an, um Luft eintreten zu lassen. Diese
Oeffnung ist so klein, daß die ganze Zeit des Kolbenhubes erforderlich ist, um den
Cylinder mit Luft zu füllen, und da diese nicht plötzlich entweichen kann, so bildet
sie für den Kolben ein Polster. Die theilweise Leere, welche unter dem Kolben
entsteht und die Zusammenpressung der über dem Kolben befindlichen Luft begünstigen
die Wirkung der Feder.
Nachdem die Pfähle auf Flößen an den Arbeitsplatz gebracht worden sind, befestigt man
die Rammklötze mittelst eines durch die Laufruthen gesteckten Bolzens, oben an der
Ramme. Die Betriebsketten werden losgemacht und an einen Pfahl angehakt, welcher
dann durch die Maschine aufgehißt und eingestellt wird. Die ganze Arbeit geht mit
großer Geschwindigkeit von statten, wozu die eigenthümliche Form des Hakens V (Fig. 6), welcher dazu
dient die Kette an den Fallblock zu befestigen, wesentlich beiträgt.
Dieser Haken, welcher leicht mit der Hand losgelöst werden kann, bietet eine große
Sicherheit dar, einerseits durch seine Widerstandsfähigkeit, andererseits weil er
sich unmöglich aus dem Ring lösen kann, während der Rammklotz aufgezogen wird.
Das Gewicht und der Preis dieser neuen Ramme betragen nur ein Viertel von dem Gewicht
und Preis der Dampframmen von Nasmyth
Nasmyth's Dampframmmaschine ist im polytechn.
Journal Bd. CXI S. 13
beschrieben. und Morrison; und da sie unter den gegebenen
Umständen wegen ihrer leichtern Verrückung eben so viele Pfähle per Tag einschlagen kann, wie diese letzteren, so
gewährt sie eine große Ersparniß. Das Aufhissen, Einstellen und Einrammen der Pfähle
erfordern bei dieser Ramme nur eine einzige Dampfmaschine von vier Pferdekräften,
während die anderen Rammen durch zwei getrennte und viel kräftigere Dampfmaschinen
betrieben werden. Allerdings sind aber die Rammen von Nasmyth und Morrison vortheilhafter wenn es
sich darum handelt, eine große Anzahl von Pfählen innerhalb eines beschränkten
Raumes einzuschlagen.
Der Preis der neuen Ramme, mit der tragbaren Dampfmaschine und den drei Rammklötzen,
beträgt 11,250 Francs.
Tafeln