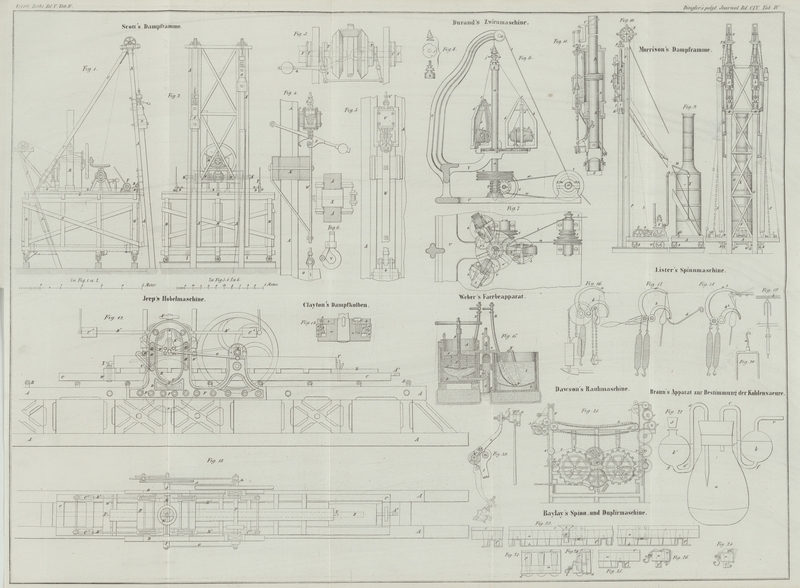| Titel: | F. Durand's Zwirnmaschine. |
| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. LXXXI., S. 267 |
| Download: | XML |
LXXXI.
F. Durand's Zwirnmaschine.
Aus dem Bulletin de la Société
d'Encouragement, durch die schweizerische polytechnische Zeitschrift Bd.
IV S. 6.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Durand's Zwirnmaschine..
Man hat oft versucht, die beiden auf einander folgenden entgegengesetzten Drehungen
des gezwirnten Garnes (Nähfaden, Cordonnet etc.) gleichzeitig und auf der gleichen
Maschine vorzunehmen, ist aber meistens daran gescheitert, daß man den verschiedenen
Fäden, welche gleichzeitig an dem einen Ende einzeln, an dem andern zusammen gedreht
werden müssen, keine gleichmäßige Spannung geben konnte; ohne diese wird der Zwirn
hohlsträngig und taugt nichts. Um diese Schwierigkeit zu beseitigen, wendet Durand eine bewegliche Lehre mit so viel Gängen an, als
Fäden zusammen gezwirnt werden sollen. Die Fäden treten einzeln in dieselbe ein und
vereinigen sich hinter derselben zur entgegengesetztesten Drehung. Diese Lehre sitzt
wie ein Hut frei auf der Spindel und neigt sich in Folge dessen immer der Richtung
zu, wo ein stärker gespannter Faden durchläuft; dadurch wird aber der schlaffere
Faden wieder angezogen und es wirkt somit jene Lehre im eigentlichen Sinne des
Wortes als selbstthätiger Regulator für die gleichmäßige Spannung der Fäden. Die
Drehvorrichtungen für
die einzelnen Fäden sind in der erforderlichen Anzahl gleichmäßig um die Spindel
herumgruppirt; in der beigegebenen Zeichnung ist die Vorrichtung für dreifädigen
Zwirn angenommen. Endlich ist das Ganze so angeordnet, daß es einen möglichst
kleinen Raum in Anspruch nimmt.
Fig. 6 zeigt
den Aufriß und Fig.
7 den Grundriß der Maschine, welche je nach Bedürfniß in größeren oder
kleineren Dimensionen ausgeführt werden kann.
Das Gestelle U ist mit einem Schnabel U' versehen, welcher die Leitrolle k trägt. Die Spindel a steht
unten in einer Pfanne und wird etwas weiter oben von dem Arme Y des Gestelles in einem Lager gehalten. Auf der Spindel ist die Scheibe
a' befestigt, welche die mit horizontalen Spulen c versehenen Gehäuse b
trägt. Diese letzteren stecken mit einem Zapfen in jener Scheibe und können sich um
ihre verticale Achse drehen, während sie gleichzeitig mit der Scheibe eine rotirende
Bewegung um die Spindelachse erhalten. Die Zahl dieser Gehäuse oder Spulrahmen kann
nach Bedürfniß gewechselt werden; in vorliegender Maschine befinden sich drei solche
in gleichmäßiger Vertheilung um die Spindel herum.
Die Spulen c stecken auf Seelen, die sich leicht
herausnehmen lassen, und jede derselben ist mit mehreren zusammengezettelten Fäden
umwickelt. Um diese beim Abrollen in einer gewissen Spannung zu erhalten, werden
dieselben durch einen rechtwinkelig umgebogenen Fadenführer d gezogen und müssen wieder in das Auge e des
Bügels oder Gehäuses zurückkehren, wodurch ein Zusammendrehen der Fäden auf der
Spule verhindert und erst beim Austritte derselben aus dem Auge e in Folge der Rotation des Gehäuses ermöglicht wird.
Damit sich die Spulen nicht zu schnell abwickeln, wird eine Klappe g mittelst der Feder f an
einen der Ränder der Spule sanft angedrückt.
Die einzelnen Fäden einer Spule werden also gleich beim Austritte bei e zusammengezwirnt und die drei einfach gezwirnten
Schnüre laufen nur gegen den gemeinschaftlichen Kopf der Spindel a, woselbst sie sich erst beim Austritte aus der Spitze
i zu einer einzigen Schnur vereinigen. Die
Combination dieses Kopfes zeigt Fig. 8; der unterste Theil
h wird auf der Spindel befestigt und die Spitze i auf jenen geschraubt. Zwischen diesen beiden Stücken
befindet sich ein Scheibchen j mit so vielen
Einschnitten, als Zwirnfäden vereinigt werden sollen; sie kann sich frei um den
Zapfen des Stückes h herumbewegen und dient als Spannungs-Regulator, indem sie sich immer nach der
Seite dreht, wo ein stärker gespannter Faden sich befindet und somit die Spannungen
dieses und des schlafferen Fadens ausgleicht. Der fertig gezwirnte Faden l wird über die Rolle k nach einer zweiten m geführt, wo er sich einige Male kreuzt und dann auf
eine (hier nicht angegebene) Spule aufgewickelt wird.
Die Bewegung der einzelnen Theile geht auf folgende Weise vor sich: die Spindel a wird durch den doppelten Schnurlauf n gedreht; durch das auf der Spindel befestigte Rad o erhalten die auf der Scheibe a' liegenden Blätter p ihre Drehung und diese
greifen wiederum in die auf den Achsen der Spulenrahmen b befindlichen Getriebe t ein. Die Schraube
q überträgt durch das Getriebe r und die Schnurläufe s und
t die Bewegung auf die Rolle m. Durch diese Combination ist die Drehungsrichtung der zweiten Zwirnung
derjenigen der ersten entgegengesetzt.
Tafeln