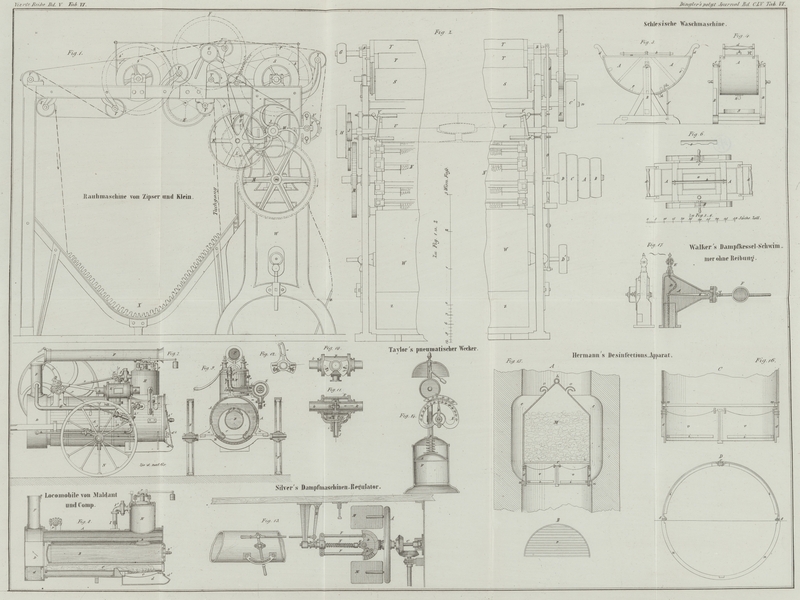| Titel: | Locomobile mit variabler Expansion und entlastetem Vertheilungsschieber, von Maldant und Comp., Maschinenfabrikanten in Bordeaux. |
| Fundstelle: | Band 155, Jahrgang 1860, Nr. CXIV., S. 401 |
| Download: | XML |
CXIV.
Locomobile mit variabler Expansion und
entlastetem Vertheilungsschieber, von Maldant und Comp., Maschinenfabrikanten in Bordeaux.
Aus Armengaud's Génie industriel, Februar 1860, S.
57.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Maldant's Locomobile mit variabler Expansion und entlastetem
Vertheilungsschieber.
Diese Locomobile war unter der interessanten Sammlung von Maschinen, welche die HHrn.
Maldant und Comp. zur Ausstellung von Bordeaux lieferten. Sie ist besonders durch die große Einfachheit ihrer Organe
bemerkenswerth, und durch einen neuen Dampfvertheilungsmechanismus, welcher den
Zweck hat, den Dampfdruck auf den gewöhnlich bei Dampfmaschinen angewandten
Vertheilungsschieber zu vermeiden. Hr. Maldant
beschäftigt sich seit längerer Zeit mit dieser wichtigen Frage, und er hatte bereits
auf der allgemeinen Pariser Industrieausstellung im Jahre 1855 eine horizontale
Maschine ausgestellt, welche mit entlasteten Schiebern versehen war.
Besondere Beachtung verdient außerdem noch der Umstand, daß der Kessel der Locomobile
mit einer Siederöhre versehen ist, durch welche eine große Heizfläche erzielt wird,
ohne daß Feuer- oder Rauchröhren angewendet werden, welche so häufig
derartige Apparate dienstuntauglich machen.
Beschreibung der Locomobile.
Fig. 7 ist
eine äußere, verticale Ansicht der ganzen Maschine. Fig. 8 ist ein
Längendurchschnitt mitten durch den Kessel, Fig. 9 ein verticaler
Querdurchschnitt nach der Linie 1 – 2 – 3 – 4, welcher
gleichzeitig durch den Vertheilungsmechanismus oder die Steuerung geht.
Fig. 10
stellt den Dampfcylinder im Detail dar, und zwar von der Seite angesehen, auf
welcher sich die Platte mit den Dampfcanälen befindet.
Fig. 11 ist
ein Durchschnitt des Cylinders mitten durch die Steuerung, und Fig. 12 eine Ansicht der
die Stelle des Dampfschiebers vertretenden neuen Vorrichtung.
Die Maschine besteht, wie alle Apparate dieser Art, aus einem Kessel A, der mit einem innen liegenden Siederohr (bouilleur) B versehen ist,
welches mit dem cylindrischen Hauptkessel durch die Verbindungsröhre b in Verbindung steht. Eine Feuerungsröhre C umgibt das Siederohr und leitet die Flamme und den
Rauch in die Rauchkammer D. Diese ist unten mit einem
Behälter d versehen, in welchem sich das Speisewasser
befindet, damit es durch die abziehenden Verbrennungsproducte erwärmt wird. Die
Feuerung hat einen geneigten Rost c, welcher durch den
Aschenkasten d verschlossen ist. An letzterem befindet
sich eine Thür d', die man durch eine Kette d² (Fig. 7) nach Bedürfniß
offen erhalten kann.
Auf dem Kessel A sind die Lager p befestigt, in welchen die Schwungradwelle a
liegt, die mit einer Kurbel a' und einer als Schwungrad
dienenden Riemenscheibe V versehen ist. Auf den Kessel
A ist der Dampfdom H
aufgesetzt, welcher wie gewöhnlich mit einem Wasserstandsglas l, mit einem Manometer o und zwei
Sicherheitsventilen r versehen ist.
An die Ränder des Dampfcylinders E sind zwei Träger m angegossen, mittelst welcher der Cylinder auf den
Kessel befestigt ist.
Durch die gebogene gußeiserne Röhre I, welche mit einem
Hahnen I' versehen ist, gelangt der Dampf aus dem
Dampfdom H in die Vertheilungscanäle und den Cylinder.
Aus dem Cylinder entweicht der Dampf durch die Röhre K,
welche in den Kamin F mündet.
Die Zuführung des Dampfes bald auf die eine, bald auf die andere Seite des Kolbens
n (Fig. 11) geschieht durch
den Sector v (Fig. 12), welcher mit
vier Oeffnungen versehen ist, von denen zwei, y und y', mit den Zuführungscanälen correspondiren, während
die beiden anderen z und z'
die Verbindung mit der Dampfabzugsröhre herstellen.
In die Mitte des Sectors mündet von der einen Seite die Dampfzuführungsröhre, von der
andern die Abzugsröhre, und derselbe ist noch mit einer Verstärkung i versehen, welche als Stopfbüchse zur Verbindung mit
der Röhre I dient.
Die mit den Eintrittsöffnungen x und x' versehene Platte des Cylinders ist vollkommen eben
geschliffen, und hat in ihrer Mitte eine cylindrische Vertiefung, in welche ein an
dem Sector v angebrachter Ansatz von derselben Form
vollkommen genau paßt.
Eine eiserne Stange i', welche in den an die Röhre I angegossenen Träger eingeschraubt ist, dient dazu, die
eben geschliffenen Flächen der Cylinderplatte und des Sectors so dicht an einander
zu halten, daß kein Dampf entweichen kann.
Aus den Figuren
10, 11 und 12 ist leicht der Weg zu erkennen, welchen der Dampf macht, wenn der
Sector v kreisförmig hin und zurück bewegt wird. Diese kreisförmig
abwechselnde Bewegung erhält der Sector v durch die
Zugstange e, welche durch ein auf die Schwungradwelle
a aufgekeiltes Excentricum bewegt wird. So wird
z.B., wenn die Oeffnung x des Cylinders in Verbindung
mit der Oeffnung z des Sectors ist, die Oeffnung x' mit der von y'
communiciren. Der Dampf gelangt dann auf die rechte Seite des Kolbens, und entweicht
von seiner linken Seite weg, wie dieß die Pfeile in Fig. 11 anzeigen.
Natürlich findet das Gegentheil statt, wenn die Oeffnungen z' und y in Verbindung mit denen des Cylinders
x und x' stehen.
Um die gewöhnlich als Kolbenstangenführung dienenden Schieber zu vermeiden, brachte
Hr. Maldant an dem Dampfkolben n zwei Röhrenstücke k an, welche sich in den
an beiden Cylinderenden angebrachten Stopfbüchsen bewegen. Der Kolben wirkt auf die
Zugstange X, welche ihrerseits die Bewegung auf die
Achse a mittelst der Kurbel a' überträgt.
Die Speisung des Kessels geschieht durch die Pumpe g,
welche mit einer Saugröhre h versehen ist, die in den
Recipienten d einmündet. In diesem Recipienten befindet
sich das durch die Verbrennungsproducte vorgewärmte Speisewasser. Von der Pumpe aus
geht letzteres durch die Steigröhre h' in den
Kessel.
Die Speisepumpe wird durch die Zugstange f in Bewegung
gesetzt, die an das Auge der Bleuelstange X angehängt
ist.
Der ganze Mechanismus ist durch die Träger u fest mit der
Achse M verbunden.
Die eisernen Räder N haben flache Felgen und Speichen mit
rechtwinkeligem Querschnitte. Sie sind, wie leicht ersichtlich, äußerst einfach
construirt, und zum Dienste der Maschine ganz geeignet.
Aus der allgemeinen Anordnung der Locomobile geht hervor, daß in Bezug auf große
Einfachheit die Erbauer alles Mögliche geleistet haben. Durch den neuen, äußerst
zweckmäßig angeordneten Steuerungsmechanismus wurde außerdem der den Nutzeffect der
gewöhnlichen Dampfmaschinen schmälernde Dampfdruck auf den Schieber vermieden.
Nach Mittheilungen des Hrn. Maldant geht aus den von Hrn.
Clamageran angestellten Versuchen hervor, daß eine
Locomobile dieses Systems bei einem Dampfdruck von 5 Atmosphären in 10 Stunden 125
Liter Newcastle-Kohlen, also stündlich 12,50 Liter verbraucht hat. Diese
Kohle ist sehr schwer, und der Hektoliter wiegt 88 Kilogr. Die Maschine verbrauchte
also 11 Kilogr. in einer Stunde, und da sie 5 Pferdekräfte hat, so wurden stündlich
für jede Pferdekraft 2,22 Kilogr. Steinkohlen verbraucht.
Tafeln