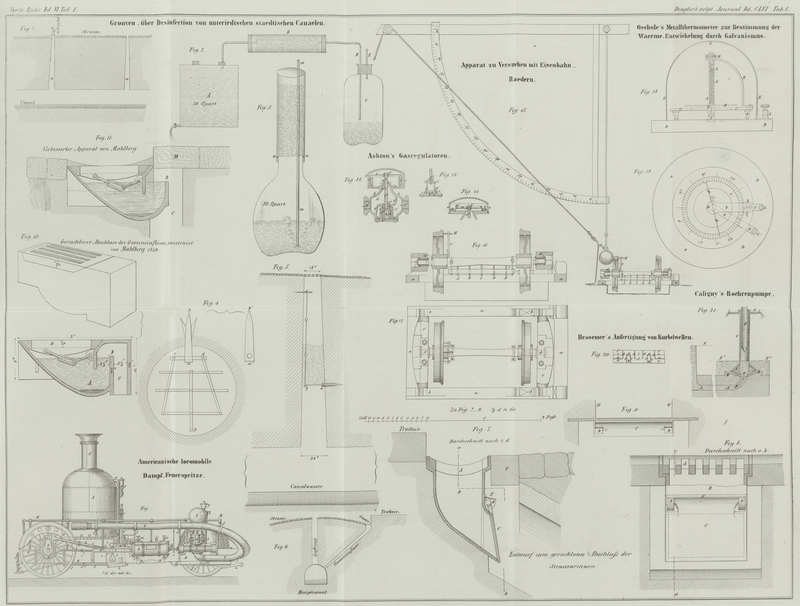| Titel: | Caligny's Röhrenpumpe. |
| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. I., S. 1 |
| Download: | XML |
I.
Caligny's Röhrenpumpe.
Aus Armengaud's Génie industriel, Januar 1860, S.
53.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Caligny's Röhrenpumpe.
Die Hebevorrichtung des Hrn. de Caligny hat den Zweck,
einfach durch die mechanische Wirkung des Wassers diese Flüssigkeit auf gewisse
Höhen zu heben, und so zu sagen automatisch zu wirken, indem sie sich ohne
besonderen Motor bewegt. Sie macht kleine Gefälle unter Umständen nutzbar, wo der
Gang des hydraulischen Widders nicht mehr regelmäßig ist, und wo durch Wasserräder
in Gang gesetzte Pumpen einen schlechten Nutzeffect geben. Dieser Apparat kann sehr
nützlich und vortheilhaft angewandt werden, um beim Entleeren der Kammern von
Canalschleußen einen Theil des Wassers wieder zurückzuheben, welches sonst ganz in
den Unterwassercanal übergienge. Der Apparat ist äußerst einfach und erfordert fast
gar keine Reparaturen. Er hat außerdem noch das Eigenthümliche, daß, da seine
Mündungen während des Ganges nie bedeckt oder verschlossen werden, man nie die
schädlichen Stöße des hydraulischen Widders zu befürchten hat, welche bei derartigen
Maschinen so zerstörend wirken, und die vollständig zu beseitigen man bisher
vergeblich bemüht war.
Seine Hauptwirkung besteht in einer Art von Ansaugen, und nicht in der gewöhnlichen
Wirkung des Stoßes, der das Princip des hydraulischen Widders bildet.
Die Hauptbestandtheile des Apparates können von Holz ausgeführt werden, der Schwimmer
von Korkholz, und da die Schlußflächen mit Leder garnirt sind, so halten sie um so
leichter dicht.
Dieser Apparat ist durch Fig. 21 versinnlicht.
In ein höher liegendes Bassin N oder den Oberwassercanal
mündet eine cylindrische Röhre A, die an ihrem aufwärts
gebogenen Ende in einen sehr flachen Trichter B ausgeht.
Auf dem trichterförmigen Ende der Röhre A steht eine
verticale Röhre C, welche einen größeren Durchmesser als
die Röhre A hat, aber unten so weit verengt ist, daß sie
sich mit einer Ringfläche
D, von demselben Durchmesser wie die Röhre A, an letztere anschließt. Die gemeinschaftliche
Berührungsfläche D der beiden Röhren ist mit Leder
garnirt.
Die große Röhre C ist oben mit einem ringförmigen,
umgebogenen Rande versehen, welcher den Rand der in der Mitte des Aufnahmbassins G angebrachten Mündung überragt und bedeckt. Das Bassin
G ist in einer gewissen Höhe angebracht, die sich
nach dem Nutzeffect des Apparates richtet. Die Röhre C
läßt sich ganz leicht in der Oeffnung des Gefäßes G
verschieben, und diese, so wie weiter unten aber über dem Schwimmer E in verschiedenen Höhen angebrachte Metallringe dienen
der Röhre C bei ihren verticalen Bewegungen als Führung.
An ihrem unteren Ende ist die Röhre C mit einem
ringförmigen Schwimmer E von Kork oder Holz versehen,
welcher ungefähr die Form des Trichters B an der
Zuführungsröhre A hat.
In den oberen Theil der Röhre C ragt ein massiver
Cylinder F von bestimmtem Durchmesser, der aber kleiner
ist als der innere Röhrendurchmesser, hinein. Dieser Cylinder F, welcher gewöhnlich von Holz ist, ist bleibend befestigt, und hindert
die auf und ab gehenden Bewegungen der Röhre C nicht im
mindesten.
Hiernach wird man den Gang des Apparates verstehen können. Ist die Röhre C gehoben, so fließt natürlich das Wasser zwischen dem
Trichter und dem Schwimmer in den Unterwassercanal. Ist die Röhre niedergedrückt, so
ruht sie auf dem Sitze D und bildet mit der Röhre A ein zusammenhängendes Ganzes.
Denkt man sich die Röhre C niedergedrückt, so daß ihr
unteres Ende auf dem Trichter B aufruht, so steigt
natürlich das Wasser in der Röhre C so lange, bis seine
Oberfläche auf gleicher Höhe mit dem Wasserspiegel in dem Oberwassercanal steht.
Läßt man dann die Röhre frei, so steigt sie in dem Anfangs ruhenden Wasser, durch
ihren Schwimmer dazu veranlaßt, in die Höhe. Das Wasser aus dem Obercanal wird nun
rasch zwischen dem Trichter B und dem Schwimmer E ausströmen. Bei dieser Ausströmung wird in Folge des
geringen Seitendruckes des rasch ausströmenden Wassers und vielleicht auch durch die
sich über dem Schwimmer bildenden Wirbel der Schwimmer nicht mehr wie vorher
gehoben, sondern es wird, da der Druck auf seine untere Fläche kleiner geworden ist,
das Gewicht der Röhre jetzt die Oberhand bekommen, so daß diese sammt dem Schwimmer
sinkt und die vorige Ausflußöffnung plötzlich verschließt. Da nun aber das Wasser in
der Zuführungsröhre A in Folge des stattgefundenen
Ausflusses noch in Bewegung ist, und diese Bewegung nicht plötzlich verlieren kann,
so springt dasselbe in der Röhre C in die Höhe. Es begegnet hier der
unteren Fläche des fest stehenden Dornes F, und da nun
in Folge davon ein Gegendruck auf den conischen unteren Theil D der Röhre C stattfindet, so wird die Rühre
C trotz des Schwimmers niedergedrückt bleiben, und
das Wasser wird nun, da es seine Geschwindigkeit noch nicht völlig abgegeben hat,
sich rings um den Dorn F erheben und oben in das Bassin
G ausfließen. Ist das Wasser dann in der Röhre C wieder zur Ruhe gekommen, so kann auch der Schwimmer
wieder wirken, die Röhre C wieder heben, und die eben
erklärte Erscheinung tritt jetzt wiederholt auf.
Um den Stößen in dem gebogenen Theile der Röhre A zu
begegnen, wurde in denselben eine kreisförmig gebogene Platte P eingefügt, welche, indem sie den Flüssigkeitsstrahl theilt, auf eine
sehr merkliche Weise den Stoß vermindert. Es wäre vielleicht gut, mehrere solche
Platten anzubringen, wenn die Biegung der Röhre sehr kurz ist.
Tafeln