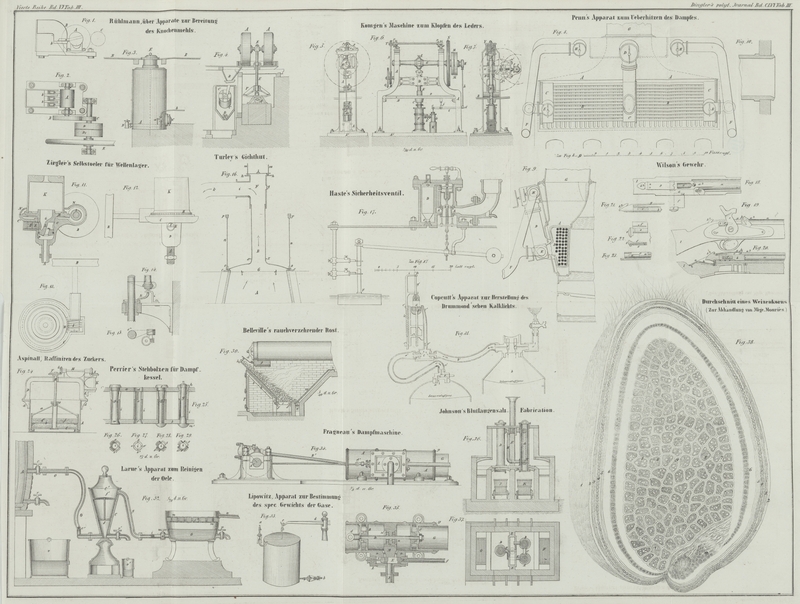| Titel: | Perrier's Stehbolzen für Dampfkessel. |
| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. XLVII., S. 174 |
| Download: | XML |
XLVII.
Perrier's Stehbolzen für Dampfkessel.
Aus Armengaud's Génie industriel, März 1860, S.
153.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Perrier's Stehbolzen für Dampfkessel.
Bei der Construction von Dampfkesseln ist es unumgänglich nothwendig, gewisse Flächen
so abzusteifen, daß die einander gegenüber liegenden Wandungen sich weder einander
nähern, noch sich von einander entfernen können. Man erreicht diesen Zweck durch die Anwendung von
Stehbolzen, welche zwischen die abzusteifenden Flächen genietet werden. Die
Stehbolzen bestehen gewöhnlich aus zwei Theilen, nämlich dem eigentlichen Bolzen und
einer Hülse, durch welche der Bolzen geschoben wird.
Dieses System von Stehbolzen, welches gewöhnlich das billigere ist, ist mit der
Unannehmlichkeit behaftet, daß es sehr schwierig, ja in manchen Fällen fast
unmöglich ist, von Hand die cylindrischen Hülsen an Ort und Stelle zwischen die zwei
abzusteifenden Wandungen zu bringen. Dieser Uebelstand findet insbesondere bei den
Locomotivkesseln statt, bei denen die Flächen, welche die doppelte Wand der
Feuerbüchse bilden, nur 8 bis 10 Centimeter von einander entfernt sind.
Um diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Hr. Perrier die in
den Figuren
25–29 abgebildeten Stehbolzen erfunden, welche ihm in Frankreich am 11.
Januar 1859 patentirt wurden.
a und b stellen die zwei in
gleicher Entfernung von einander zu haltenden Wände vor. Dieselben sind mit
Bohrungen versehen, welche mit einander correspondiren, d.h. einander gerade
gegenüber liegen. Die Bohrungen c in der Wand b sind gerade so weit, als die eigentlichen
Bolzenschäfte g dick sind. Die Löcher in der Wand a sind dagegen so weit, als die cylindrischen Hülsen i außen dick sind. Die Bolzen haben die gewöhnliche Form
und sind entweder mit einem versenkten Kopfe m, welcher
der Bohrung c entspricht, oder mit einem halbrunden
Kopfe m' versehen. Die cylindrische Hülse i ist auf die gewöhnliche Weise dargestellt, nur ist sie
an dem einen Ende auf eine gewisse Tiefe übers Kreuz aufgeschnitten, wie dieß Fig. 27 bei
o, o', s, s' zeigt.
Die so vorbereitete Hülse wird, mit dem unaufgeschnittenen Ende voraus, durch die
Bohrung d zwischen die zwei Blechwände a und b eingeschoben; dann
steckt man durch die enge Oeffnung c einen Dorn von dem
Durchmesser des Bolzens, um die Hülse vorläufig an ihrem Platze zu erhalten. Von der
entgegengesetzten Seite treibt man hernach einen conischen Dorn e ein, welcher den Zweck hat, den aufgeschnittenen Theil
der Hülse aufzutreiben, so daß dieser Theil die Form von Fig. 26 annimmt. Ist dieß
geschehen, so steckt man den gewöhnlichen Bolzen durch und vernietet die Köpfe.
Der Bolzen kann auch in der Platte b (wie bei m', Fig. 25) etwas conisch
geformt seyn; die Hülse ist, wie schon erwähnt, oben aufgetrieben und die Bohrung in
der Platte a ist etwas weiter als es zum Einschieben der
Hülse nöthig ist. Man bringt nun in diese erweiterte Bohrung ein Scheibchen h von besonderer Form, steckt dann den Bolzen g durch, der mit seinem sich an den Kopf m'
anschließenden Conus sich an die Platte b dicht anlegt,
und nietet dann den zweiten Bolzenkopf in die conische Höhlung der Scheibe h.
Es ist nun leicht einzusehen, daß man durch diese verschiedenen Systeme nicht nur die
Entfernung der Wandungen a und b von einander, sondern auch ihre gegenseitige Annäherung verhütet, da die
durch die Bolzen an Ort und Stelle gehaltenen und an einem Ende ausgeweiteten Hülsen
i die Wandungen von einander entfernt halten.
Tafeln