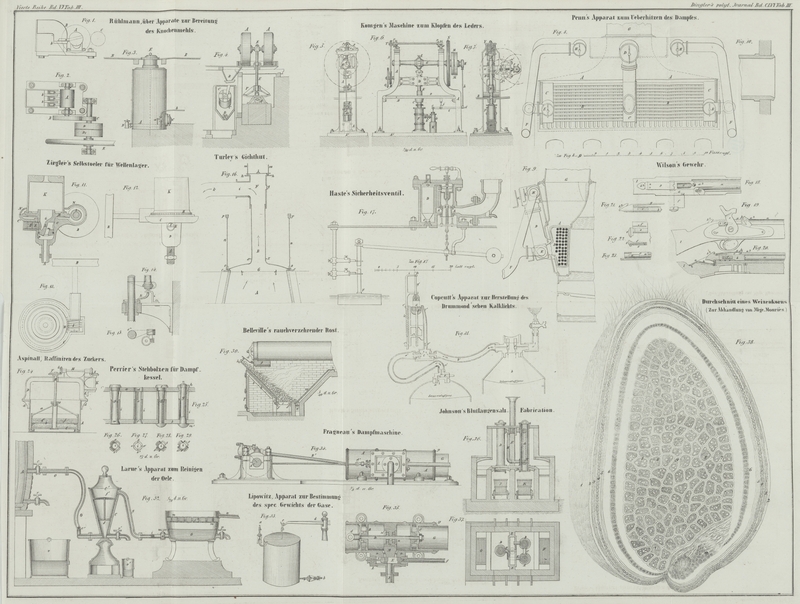| Titel: | Komgen's Maschine zum Klopfen des Leders. |
| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. L., S. 179 |
| Download: | XML |
L.
Komgen's Maschine zum Klopfen des Leders.
Aus Armengaud's Génie industriel, März 1860, S.
125.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Komgen's Maschine zum Klopfen des Leders.
Das Klopfen des Leders, welches den Schluß des Gerbprocesses bildet, ist eine der
wichtigsten Manipulationen der Lederfabrication. Diese Arbeit, welche lange Zeit
hindurch mit der Hand ausgeführt wurde, geschieht jetzt durch mechanische
Vorrichtungen.
Wir beschreiben im Folgenden eine derartige Maschine, welche sich Hr. Komgen in Paris für Frankreich patentiren ließ.
Fig. 5 ist
eine Ansicht von der hintern Seite der Maschine;
Fig. 6 eine
Vorderansicht derselben;
Fig. 7 eine
Seitenansicht derselben, welche einige Abänderungen des Hauptapparats zeigt.
Diese Maschine besteht aus einem Gestelle A, gebildet aus
zwei Ständern, welche durch eine Grundplatte A' und
durch eine Platte B verbunden sind, die in der Mitte
ausgespart ist, um den Raum für den Amboß herzustellen, auf welchen der Stempel E wirkt, und endlich aus dem Leitungsstücke D für den Stempel.
Um nun das Zerquetschen des Leders in Folge des zu großen Widerstandes des Amboßes zu
verhindern, ist dieses in einen hohlen gußeisernen Cylinder F gestellt, welcher eine Reihe auf einander gelegter, aber von einander
durch Blechplatten getrennter Scheiben von Kautschuk, Leder, Gutta-percha
oder einem andern elastischen Stoff enthält. Es ist einleuchtend, daß diese Scheiben
bei einem großen Widerstande des Leders zusammengedrückt werden und der Amboß durch
sein Weichen der Zerstörung des Leders vorbeugt.
Anstatt solche elastische Scheiben anzuwenden, könnte man aber auch den unteren Theil
des Cylinders mit dem Dampfkessel der Dampfmaschine in Verbindung setzen, welche den
Apparat in Bewegung setzt; ein solcher Dampfpolster unter einem Kolben würde den
beabsichtigten Zweck vollständig erfüllen.
Statt des Dampfpolsters könnte man auch comprimirte Luft anwenden, welche wie eine
Feder wirkt. In diesem Falle erhält die Betriebswelle G
an ihrem Ende ein Excentricum H, welches mittelst einer
Bleuelstange h und eines um einen festen Punkt j sich bewegenden Balanciers
i den Kolben k einer
Luftpumpe K treibt, die mit dem Innern des Cylinders F communicirt. Nachdem die Luft die bestimmte Pressung
erlangt hat, schneidet man vermittelst eines Hahnes k'
die Verbindung der Luftpumpe mit dem Cylinder ab, hernach stellt man diese Pumpe ab
und zwar entweder durch Loslösen des Excentricums, oder durch Herausnehmen des
Bolzens aus dem Gelenke c oder d.
Der Stempel E wird entweder durch einen Krummzapfen der
Betriebswelle in Bewegung gesetzt, oder durch ein auf diese aufgekeiltes Excentricum
L, welches seine Bewegung vermittelst der
Riemenscheiben M und M'
erhält, von denen die eine fest, die andere lose ist. Die Welle G ist überdieß mit einem Schwungrade N versehen.
Das Lederstück O ist auf dem Tische B über den festen Amboß C
hin ausgebreitet, und der Stempel E, welchem das
Querstück D zur Leitung dient, schlägt auf das Leder,
welches der Arbeiter bei jedem Schlage des Stempels auf den Amboß verrückt.
Die Betriebswelle G liegt in Lagern g (Fig. 5), welche in
Coulissen des Gestells A sich bewegen. Diese Lager
hängen an Stellschrauben o, an deren anderm Ende
Winkelräder o' sitzen, welche durch correspondirende auf
die Welle P aufgekeilte Winkelräder p gleichzeitig bewegt werden. Diese Welle ist mit einem
Getriebe T versehen, welches vermittelst einer Kette
ohne Ende S die rotirende Bewegung von einem andern
Kettenrade R erhält. An dessen Welle sitzt ein kleines
Stellrad Q, und durch diese Einrichtung ist man im
Stande die Betriebswelle G entweder zu heben oder zu
senken und somit den Zwischenraum zwischen der Stempelbahn und dem feststehenden
Amboße zu vermehren oder zu vermindern.
In Fig. 7 ist
eine Modification des eben beschriebenen Apparates dargestellt.
Das Querstück D, welches den Stempel oder Hammer E trägt und seine Leitung bildet, ist mit zwei Coulissen
versehen, welche die senkrechte Bewegung einem mit einer Schraube u befestigten Knaggen U
gestatten.
Die Welle G trägt einen Hebedaumen V, welcher durch den Knaggen U den Stempel in
die Höhe hebt und sofort wieder fallen läßt.
Oberhalb der Stempelstange befindet sich ein Kolben X,
welcher unter einer von elastischen Scheiben gebildeten Feder liegt. Diese Feder ist
in einem gleich an das Querstück angegossenen Cylinder eingeschlossen.
Die elastischen Scheiben werden durch einen Bolzen x
vereinigt, welcher am Stempel befestigt wird und zu dessen verticaler Führung
dient.
Wie man sieht, liegt in diesem Falle die Bewegungswelle nicht in der Achse des
Stempels, sondern ist an der Seite der Ständer in A² angebracht. Ihre Lager sind horizontal beweglich, und zwar
vermittelst der Schrauben r, welche durch die Winkelräder s und t bewegt werden. Diese
letzteren sind auf einer Welle befestigt, die mit einem Stellrädchen versehen ist,
durch welches die Welle in horizontaler Richtung gestellt und dem Daumen V ein entsprechender Angriff gegeben werden kann.
Es ist leicht einzusehen, daß der Stempel jedesmal, wenn er gehoben wird, die Feder
zusammendrückt, welche bei ihrem Bestreben sich wieder auszudehnen, den Stempel,
nachdem der Daumen seinen Hub vollendet hat, sogleich mit Gewalt auf den Amboß
wirft.
Tafeln