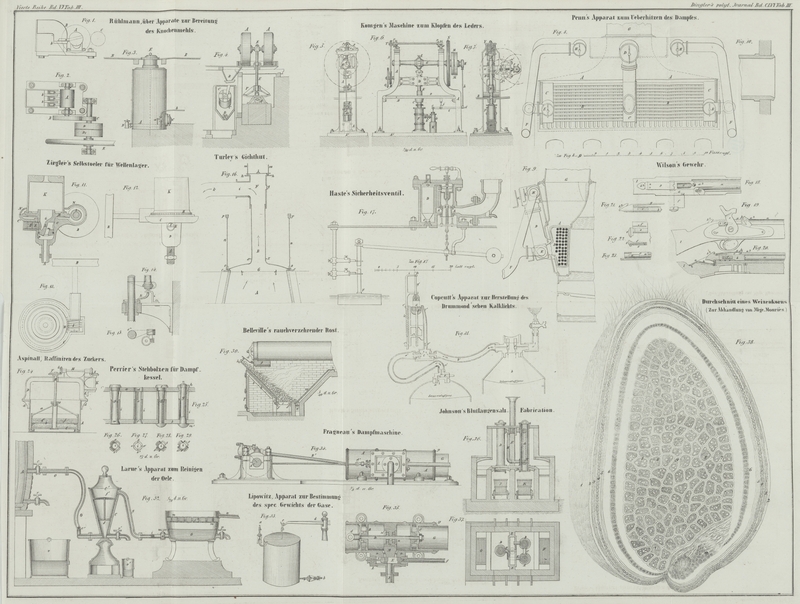| Titel: | Gichthut zur Ableitung der Hohofengase; von B. Turley, Bergingenieur. |
| Fundstelle: | Band 156, Jahrgang 1860, Nr. LVII., S. 194 |
| Download: | XML |
LVII.
Gichthut zur Ableitung der Hohofengase; von
B. Turley,
Bergingenieur.
Aus der berg- und hüttenmännischen Zeitung, 1860,
Nr. 16.
Mit einer Abbildung auf Tab. III.
Turley's Gichthut zur Ableitung der Hohofengase.
Die bisher üblichste Ableitungsart der Gase aus den Eisenhohöfen zu weiterer
Benutzung geschieht durch eine Oeffnung, welche man theils, unmittelbar unter der
Gichtsohle, theils in geringerer oder in größerer Tiefe unter derselben im
Ofengemäuer anbringt. Dabei werden die Gase durch einen in den Schacht gehängten
Cylinder abgefangen, welcher zwischen sich und jenem einen Zwischenraum von einigen
Zollen läßt. Auf die Unvollkommenheiten dieser Ableitungsart, die namentlich darin
bestehen, daß dem Ofen, je nach der früheren oder späteren Ableitung der Oase, mehr
oder weniger nutzbare Wärme entzogen, und daß der Gasstrom von feinem natürlichen
Wege von unten nach oben in dem oberen Theil des Ofens abgelenkt wird, was auf die
Röstung, überhaupt auf den ganzen Betrieb nicht ohne nachtheiligen Einfluß bleibt,
ist bereits von verschiedenen Seiten im hüttenmännischen Publicum aufmerksam gemacht
worden. Aus diesem Grunde sind auch mehrere Einrichtungen angegeben worden, welche
jene Nachtheile beseitigen sollen, die aber ihren Zweck wieder mehr oder weniger
verfehlen.
So hat sich ein Herr Darby in England eine Einrichtung
patentiren lassen, die im Wesentlichen darin besteht, daß in die Mitte des Schachtes
von oben ein Rohr hineingesteckt wird, durch welches die Gase in einer gewissen
Tiefe unter der Gicht theilweise abgefangen werden sollen, die aber auch an dem
Nachtheil leidet, daß die Gase in der Mitte des Schachtes concentrirt werden, und
daß das Aufgeben und regelmäßige Niedergehen des Schmelzgutes behindert wird, zumal,
wenn man das Rohr seitlich austreten läßt.
Der in Fig. 16
gegebene Entwurf eines Gichthutes zur Ableitung der Gase besteht in Folgendem. Die
Ofengicht wird durch einen gewöhnlichen Deckel oder Hut G von starkem Eisenblech geschlossen, welcher auf dem gußeisernen
Gichtkranz c aufsitzt und sich von den bisher
angewendeten nur dadurch
unterscheidet, daß er in der Mitte in ein etwa 6' langes
Gasrohr B ausläuft. Dieses Rohr steckt mit seiner oberen
Mündung etwa 4'' in einem gußeisernen kurzen Rohr F, welchem das Knie i
angegossen ist; F hat eine solche lichte Weite, daß B darin bequem verschiebbar ist. Durch die an i befindliche Flantsche wird F mit dem Hauptgasrohr k verbunden, welches,
von Eisenblech, die Gase bis zum Verbrauchsort leitet. Bei h ist eine zweite, oben breitere Manische, welche einen verkleinerten
Gichtkranz bildet, so daß F mittelst des kleinen Deckels
1 verschließbar ist. An den Leitstangen m, welche h trägt, ist 1 verschiebbar, ebenso der Hut G an den stärkeren Stangen n, welche in den Gabeln p Rollen tragen. Ueber
diese Rollen laufen Ketten o, mit denen G, also auch B emporgezogen
wird. Die Ketten wickeln sich um eine auf der Gichtsohle befindliche Winde. Bei g ist ein Schieber zum Reinigen von F angebracht; x sind Bolzen,
welche verhindern, daß sich B in F einklemmt; das untere Ende von F befindet
sich ca. 5' über x. Die Flantsche h bietet
eine bequeme Auflagerung von F.
Ist der Ofen geschlossen, wie in Fig. 16, so strömen die
Oase gerade empor, treten durch B und F in k und so zum
Verbrauchsort; ist G geschlossen, so schließt natürlich
auch l, welches nur eine solche Schwere zu haben
braucht, daß die Gase den Deckel nicht emporheben, was man leicht durch Gewichte
erreicht. Soll der Schmelzsatz aufgegeben werden, so wird G mit der Winde so weit emporgezogen, bis x an
F stößt, wobei l von G an den Stangen in emporgehoben wird. Jetzt entweichen
leider die Gase ins Freie. Das Aufgeben geschieht wie gewöhnlich mit Wagen, welche
auf den Schienen z über die Gichtöffnung geführt werden.
Sind Kohle und Erz aufgegeben und geebnet, so wird G auf
c niedergelassen, l
setzt sich auf h und der Gasstrom nimmt seinen Weg
wieder durch B, F und k.
Maaße sind hier nicht angegeben, da die Weite der Röhren u.s.w. sich nach der
Ofengröße richtet, dieselben also den Umständen jedesmal angepaßt werden müssen.
Durch diese Einrichtung erlangt man jedenfalls den Vortheil, daß die Gase dem Ofen
erst entzogen werden, nachdem sie selbigen durch seine ganze Höhe durchströmt, und
daß sie ihren regelmäßigen, natürlichen Gang nehmen können, was nicht möglich ist,
wenn man das Gas seitlich austreten läßt. Dagegen leidet dieselbe auch an dem
gewöhnlichen Nachtheil, daß der Gasstrom durch das Aufgeben unterbrochen wird.
Dieser Unvollkommenheit hat man durch trichterförmige Aufgeber zu begegnen gesucht,
wobei das Schmelzgut beim Aufgeben einen Verschluß bilden soll, und will auf diese
Weise den Strom nie unterbrechen.
Unserer Ansicht nach aber wird dieser Zweck dadurch nie vollkommen erreicht und dann
leiden derlei Aufgeber an dem großen Fehler, daß das Schmelzmaterial nun mehr oder
weniger an die Ofenwand zu liegen kommt, so daß dadurch eine regelmäßige Vertheilung
desselben über die Anfgebefläche ganz unmöglich wird, was doch für den Betrieb immer
wünschenswerth bleibt.
Schließlich ersuche ich die Herren Ingenieurs, die angegebene Einrichtung zu prüfen,
nach Befinden abzuändern und anzuwenden.
Nachträglich kann ich nicht unterlassen, im Voraus auf einige Punkte aufmerksam zu
machen, die bei dem vorstehend beschriebenen Apparat einige technische
Schwierigkeiten haben dürften, deren geeignete Beseitigung ich den Herren
Fachgenossen deßhalb besonders zu empfehlen mir erlaube.
1) Mein Apparat bezweckt eine möglichst vollständige Ausnutzung des Brennmaterials im
Hohofen und daneben die Benutzung der zur Gichtöffnung entweichenden Gase; jener
Zweck ist der vorwiegende, dieser der nur untergeordnete. Es ist einleuchtend, daß
die Gase, wenn sie zur Gicht entweichen, dem Hohofen alle direct wirkende Kraft
abgegeben haben, und also weniger Heizkraft besitzen, als wenn sie demselben früher
entzogen werden; es ist aber jedenfalls vortheilhafter, am Brennmaterial des
Hohofens zu sparen, als durch eine zu frühe Ableitung den Gasen eine bedeutendere
secundäre Wirkung zu gestatten, da man ihnen hier mit minder gutem Material, wie
Braunkohlen und Torf, leicht zu Hülfe kommen kann, wenn die Verbrennung der Oase dem
geforderten Zweck nicht hinreichend dienen sollte. Indessen glaube ich mit
Sicherheit annehmen zu dürfen, daß die zur Gicht entweichenden Gase zur
Kesselheizung und zum Warmwindapparat vollkommen hinreichen dürften, während sie zu
anderen Zwecken, wie zum Puddeln, die eine intensivere Hitze verlangen, nicht
ausreichen.
2) Der obige Gichtdeckel wird durch das Rohr B um etwa
2 Ctr. schwerer als der bisher übliche, so daß
dessen Gesammtgewicht für eine 6' weite Gicht ca. 5 Ctr. betragen kann. Dieses Gewicht muß man durch
Gegengewichte, die sich vielleicht passend an dem Gußstück F mittelst Ketten und Rollen anbringen ließen, auszugleichen suchen. Dabei
muß auf eine hinreichende Stärke und Stabilität der Leitstangen gesehen werden, die
man durch eiserne Spreizen erreichen kann.
3) Eine Stopfbüchse in dem untern Theil von F
anzubringen, halte ich für überflüssig. Ein Spielraum zwischen B und F von ein Paar Linien
genügt zur bequemen Verschiebung, der eine Stopfbüchse sehr hinderlich wäre. Dabei,
glaube ich, wird die durch jenen engen Spielraum eindringende Luft keinen
schädlichen Einfluß auf die abströmenden Gase ausüben, noch deren Zug
beeinträchtigen.
Tafeln