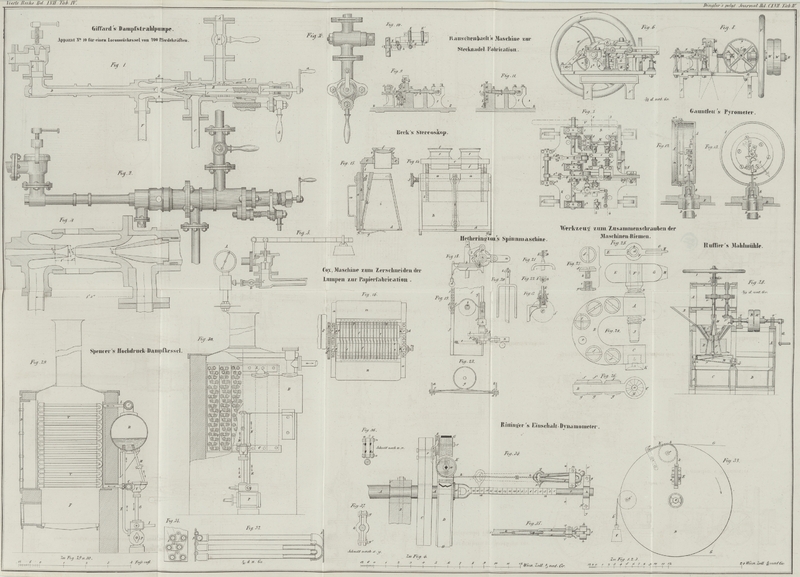| Titel: | Beschreibung eines Einschalt-Dynamometers; von J. v. Bellusich. |
| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LVIII., S. 265 |
| Download: | XML |
LVIII.
Beschreibung eines Einschalt-Dynamometers;
von J. v.
Bellusich.
Aus den Erfahrungen im berg- und hüttenmännischen
Maschinen-, Bau- und Aufbereitungswesen, 1858 S.
33.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
v. Bellusish, über ein Einschalt-Dynamometer.
Bei Bestimmung der zum Betriebe einzelner Apparate erforderlichen Betriebskraft
ergeben sich oft Fälle, wo die Localverhältnisse die Anwendung der gebräuchlichen
Bremsdynamometer u.s.w. entweder nicht gestatten, oder in irgend einer Art
erschweren, und wenn es auf eine große Genauigkeit der Messung nicht ankommt, auch
die zur Herstellung obiger, oft kostspieligen Vorrichtungen erforderlichen Auslagen
nicht lohnen. In solchen Fällen empfehlen sich dann Apparate, welche, wie der im
Folgenden zu beschreibende, in die Transmission sich leicht einschalten lassen.
Dieser bei der Pribramer Aufbereitung in Anwendung gebrachte, nach Angabe des k. k.
Sectionsrathes Hrn. Rittinger construirte und in den Figuren
33–37 dargestellte Apparat besteht in Folgendem.
Am Ende der Welle A, Fig. 34, deren
Kraftäußerung erhoben werden soll und welche bei B
aufgelagert ist, sind zwei zur Transmission gehörende hölzerne Riemenscheiben C, D angebracht. Die Riemenscheibe C ist fest aufgekeilt, während die andere D lose auf der Welle umlaufen kann. In dieser losen
Scheibe befindet sich bei E ein radialer Ausschnitt, in
welchen eine Rolle a eingesetzt und mittelst
Zapfenlagern und Schrauben an dieselbe befestigt ist. Nahe am Umfange derselben
Scheibe ist eine zweite Rolle b mittelst eines an
dieselbe befestigten Schraubenbolzens c angebracht. Die
Welle A endet in einen Schraubenbolzen, auf welchen die
in ein Muttergewinde d endigende Spindel e in der Verlängerung der Welle aufgeschraubt ist; am
Ende der letzteren sind zwei mit Schrauben g, g'
verbundene Laschen h (Fig. 36) aufgestellt. m ist eine aus drei Theilen α, β, γ (Fig 35) bestehende Schraubenklemme, deren
mittlerer, mit einem Laschenrohre versehene Theil β auf den Schraubenbolzen g aufgesteckt
und so mit h verbunden wird. Zur Verbindung der an der
inneren Seite mit Ruthen versehenen Theile α,
β, γ dienen die Schrauben n. o
stellt eine vierfach geschlungene elastische Gummischnur vor, an welche ein
eiserner, nach Abwärts in einen Stift p endigender Ring
q aufgesteckt wird; die Schnurenden dagegen werden in die Nuthen der
Schraubenklemme eingelegt und mittelst der Schrauben n
zusammengeklemmt.
An der fixen Scheibe C befindet sich eine Schiene r mittelst Schrauben befestigt, deren in ein Ohr s ausgehendes Ende mittelst einer um die Rollen a, b geschlungenen, kurzgliedrigen Rundkette k mit dem Ringe q verbunden
wird. u, u ist eine an der Spindel e auf irgend eine Art angebrachte Scala, und G der auf die lose Scheibe aufgelegte Treibriemen.
Bei Ingangsetzung dieses Apparats wird der Treibriemen die mittelst der Rollen a, b und der Kette k
zwischen die fixe Scheibe C und die Gummischnur o eingespannte lose Scheibe D mitnehmen und während des Umgangs der Welle die Schnur bis zu einem
gewissen Grade anspannen, so daß der Stift p der Scala
entlang vorrücken und während des Ganges der Maschine an derselben einen gewissen
Stand einnehmen wird. Hat man nun den Gang so adjustirt, daß die Welle e beim Gange der durch sie getriebenen Arbeitsmaschine
die ihr zukommende normale Geschwindigkeit erlangt hat, so beobachtet man mit
Berücksichtigung der Schwankungen des Stifts p den
Stand, welchen derselbe an der Scala einnimmt, und erhält auf diese Art den die
Arbeitsgröße einer Maschine zusammensetzenden einen Factor, nämlich den Druck oder Zug im linearen
Maaße ausgedrückt. Um nun diesen Zug in Gewichten ausgedrückt zu erhalten, wird die
Kraftmaschine durch Ablegen des Treibriemens, die Arbeitsmaschine dagegen durch
Losmachung der Kette aus dem Ohre s ausgehängt, die lose
Riemenscheibe derart fixirt, daß das lose Kettenende s
von der Rolle b frei herabhängt, und an das Kettenende
k' so lange Gewichte P
angehängt, bis der Stift p wieder den während des
Betriebs beobachteten Scalastand einnimmt.
Zur Ermittelung des die Arbeitsgröße zusammensetzenden zweiten Factors, nämlich der
an der Stelle des erhobenen Zuges stattfindenden Geschwindigkeit dient der zu
messende, bis zur Kette k' reichende Halbmesser be und die während des Versuchs stattgefundene
normale Umdrehungszahl der Welle. Macht z.B. die Welle 60 Umgänge pro Minute und beträgt der erwähnte Halbmesser 1,2 Fuß,
so ergibt sich die Geschwindigkeit pro Secunde aus
(1,2 × 6,28 × 60)/60 = 7,54 Fuß
und wurde das zur Spannung der Gummischnur erforderliche
Gewicht mit 50 Pfd. erhoben, so berechnet sich die gesuchte Arbeitsgröße mit 7,53
× 50 = 376,5 Fußpfund.
Selbstverständlich lassen sich mittelst dieses Apparats nur geringe, mit der Stärke
der Gummischnur im Verhältniß stehende Arbeitsleistungen messen. Uebrigens dürfte
diese Art Dynamometer in manchen Fällen nicht nur bei Riemen, sondern auch bei
Rädertransmissionen mit einigen Modificationen anwendbar seyn.
Dem Vorstehenden fügt Rittinger noch folgende Anmerkung
bei. Der Apparat würde richtiger angeordnet seyn, wenn die Scheibe D fix, hingegen C lose auf
der Achse wäre, und der über C gelegte Riemen diese lose
Scheibe mit dem Kettenende s nach der dem gezeichneten
Pfeil entgegengesetzten Richtung bewegen würde.
Tafeln