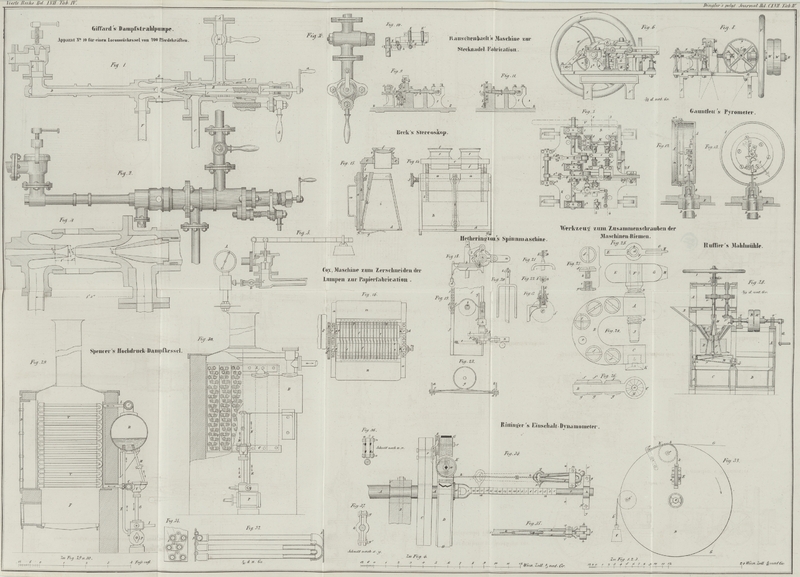| Titel: | Werkzeug zum Zusammenschrauben der Maschinen-Riemen; beschrieben von C. Karmarsch. |
| Fundstelle: | Band 157, Jahrgang 1860, Nr. LIX., S. 267 |
| Download: | XML |
LIX.
Werkzeug zum Zusammenschrauben der
Maschinen-Riemen; beschrieben von C. Karmarsch.
Aus den Mittheilungen des hannoverschen Gewerbevereins,
1860 S. 70.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Karmarsch, über ein Werkzeug zum Zusammenschrauben der
Maschinen-Riemen.
Die Zusammenfügung der Treibriemen bei Maschinen wird bekanntlich am besten durch
eiserne Schrauben bewerkstelligt, welche aus zwei Theilen bestehen, wie Fig. 27 (in
der wirklichen Größe) zeigt. Die kleine Schraubenspindel h hat einen dünnen aber breiten scheibenförmigen Kopf f, dem man entweder wie hier einen Spalt zum Einsetzen
des Schraubenziehers oder ein Paar Löcher zum Gebrauch des Gabelschlüssels gibt. Die
Mutter i (durchschnittsweise gezeichnet) ist so lang wie
h und besitzt gleichfalls einen scheibenförmigen
Kopf g, jedoch ohne Spalt.
Um die Schrauben anzubringen, werden die auf einander liegenden Riemen-Enden
gelocht; dann steckt man die Mutter i hindurch und dreht
von der entgegengesetzten Seite die Schraube h hinein.
Die bei diesen Geschäften erforderlichen Geräthe in bequemster Einrichtung
darzubieten und nebst einem kleinen Vorrathe von Schrauben in dem geringsten Raume
zu vereinigen, ist das Verdienst des in Fig. 24, 25 und 26 (in der wirklichen
Größe) abgebildeten Apparates, der in einem Ledertäschchen von nur 3 1/2 Zoll Länge,
2 3/4 Zoll Breite, kaum 3/4 Zoll Dicke verwahrt wird.
Fig. 24
stellt die Seitenansicht oder den Aufriß des Ganzen dar, Fig. 25 die obere Ansicht
einiger Theile, Fig. 26 die Ansicht von Unten.
Der hufeisenförmige Bügel A, B, C ist von Messing oder
einer gelben Bronze gegossen, in seinem mittleren halbkreisähnlichen Theile B mit sechs Löchern wie e
durchbohrt, in welche eben so viele Riemenschrauben f, g
(vergl. Fig.
27) eingesetzt werden, die man solchergestalt ohne besondern Raumbedarf
mit sich führen kann. Von den cylindrisch verstärkten Enden A und C des Bügels ist das obere, A, mit dem Muttergewinde für die stählerne
Schraubenspindel D versehen, deren Verlängerung das
Locheisen J bildet, während andererseits der messingene
(bronzene) Griff E, G aufgesteckt ist. Die Bohrung des
Locheisens setzt sich durch die Schraube I) und deren Hals b fort und erscheint in Fig. 25 bei d. Auf dem hiernach rohrförmigen Halse b sitzt der Griff E, G
mittelst seines verdickten Mitteltheiles F, wo die
Befestigung mittelst eines streng eingetriebenen und nachher überfeilten Stahlkeiles
c stattfindet. Der eine Arm G des Griffes enthält einen stählernen Schraubenzieher H. Das Gewinde an der Spindel D ist ein doppeltes mit flachen Gängen von solcher Feinheit, daß auf der
ganzen 1 Zoll betragenden Länge der Schraube 13 Gänge vorhanden sind, mithin 6 1/2
Umdrehungen erfordert würden, um die Spindel 1 Zoll weit fortzuschrauben.
Auf dem untern Ende C des Bügels A, B, C ist inwendig, d.h. auf dessen oberer Fläche, eine kleine und
seichte kreisförmige Rille angebracht, in welche die Schneide des Locheisens J eintritt, wenn dieses gänzlich herabbewegt wird.
Gegenüber, auf der Außenfläche von. C, hat man die
gehärtete stählerne Pfanne K mittelst ihres
Schraubzapfens L eingeschraubt. Die Beschaffenheit des
Theiles K geht aus einer Vergleichung der Figuren 24 und
26
hervor: er enthält im Mittelpunkte ein tiefes Grübchen a, übrigens aber eine schalenartige (flach kugelsegmentförmige) Vertiefung, in
welcher nach dem Laufe von Halbmessern 14 Meißelhiebe gemacht sind, deren jeder
einen scharfen Grath neben sich aufgeworfen hat.
Es ist nun von selbst verständlich, wie man durch Einlegen des Riemens auf C und Herumdrehen des Griffes E,
G das Lochen bewerkstelligt. Ist dieß geschehen, so dreht man die Schraube
D gänzlich heraus, stützt den Kopf g einer in das Loch des Riemens geschobenen
Schraubenmutter i in die Pfanne K und dreht nun von entgegengesetzter Seite die Schraube h ein, wobei man den Schraubenzieher H benutzt. Das hierbei nothwendige Festhalten des
Mutterkopfes erfolgt durch die Meißelhiebe in der Pfanne K sehr gut und sicher.
Tafeln