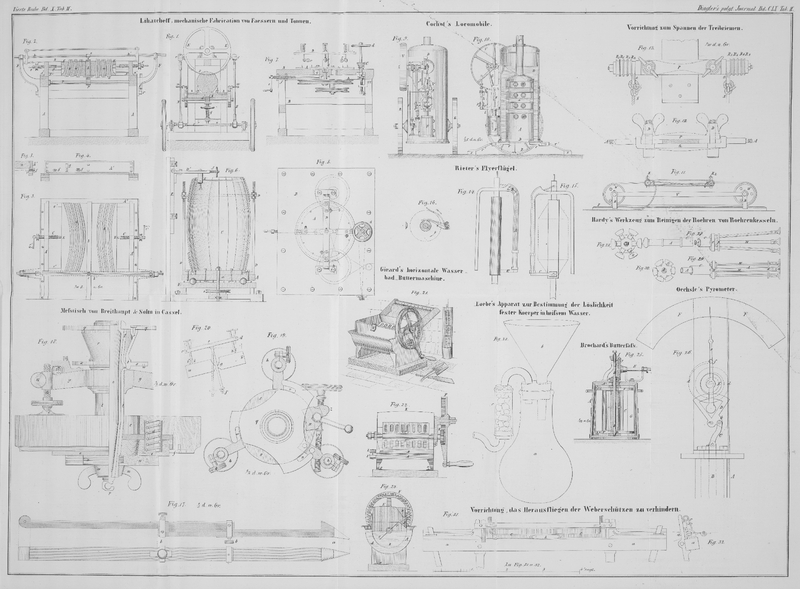| Titel: | Aräometerwaage zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Flüssigkeiten, von Otto Autenrieth, Mechaniker in Ulm. |
| Fundstelle: | Band 159, Jahrgang 1861, Nr. XXIX., S. 109 |
| Download: | XML |
XXIX.
Aräometerwaage zur Bestimmung des specifischen
Gewichts von Flüssigkeiten, von Otto
Autenrieth, Mechaniker in Ulm.
Aus dem württembergischen Gewerbeblatt, 1860, Nr.
40.
Mit einer Abbildung auf Tab. II.
Autenrieth's Aräometerwaage.
Die Einrichtung dieser Waage im Allgemeinen ist die von Dr. Mohr erfundene, und zeichnet sich dadurch
aus, daß sie an jedem genauen Waagbalken angebracht werden kann. Die in Fig. 12
abgebildete Form ist aber eigene Construction des Verfertigers und die Waage dürfte,
auf diese Art ausgeführt, das bequemste und sicherste Werkzeug für aräometrische
Wägungen seyn. Bei gehöriger Uebung sind die Resultate bis 0,001 genau, und die
Behandlung ist so einfach, daß bei gehöriger Vorsicht ein Fehler fast undenkbar
ist.
Der Balken dieser Waage hat nur zwei Achsen, nämlich eine Mittelachse zum Aufsetzen
auf das Stativ und eine äußere zum Anhängen eines gläsernen Senkels; anstatt der
dritten Achse ist ein Gewicht an den Balken geschraubt, welches den gläsernen Senkel
balancirt und mit einer kurzen Spitze versehen ist, um als Zeiger zu dienen. Dieser
Spitze steht an dem Stativ eine spitzige Schraube gegenüber, so daß die geringste
Abweichung des Balkens vom horizontalen Stande sichtbar wird; ferner ist das Stativ
an dieser Stelle hufeisenförmig aufwärts gebogen und verhindert auf diese Weise, daß
das Balancirgewicht allzu hoch gehoben wird, während zugleich zwei seitwärts
stehende Lappen verhindern, daß die Waage durch einen Stoß herabgeworfen werden
könne. In diesem Träger des Waagbalkens ist unten ein senkrechtes Stengelchen
festgeschraubt, welches sich in einer auf einem eisernen Fuße befestigten Hülse
verschieben und vermittelst einer Schraube feststellen läßt, so daß man den an einem
Platindraht hängenden Senkel in jeder beliebigen Höhe in die Flüssigkeit bringen
kann, welche man untersuchen will. Endlich ist der Waagbalken von einer Achse zur
anderen in zehn gleiche Theile getheilt und über jedem Theilstrich ist eine kleine
Kerbe eingefeilt, in welche die Reiterchen gesetzt werden, welche bei dieser Waage
die Stelle der Gewichte vertreten. Die Reiterchen bestehen aus Drähten und haben
folgende Einrichtung: a ist ein einfacher, nach der
Zeichnung gebogener Messingdraht, welcher genau so schwer ist, als eine Quantität
destillirten Wassers von dem Volumen des Senkels; hängt man also denselben über
dem im Wasser befindlichen Senkel an den Haken der Waage, so wird der Waagbalken
eben so horizontal stehen, als wenn der Senkel in freier Luft hinge und keinen Draht
über sich hätte; b ist ein zweiter Draht von gleichem
Gewichte wie a, aber unter seiner oberen Biegung mit
einer scharfen Kante versehen, mit welcher er in eine der Kerben über den
Theilstrichen gesetzt wird; c und d sind ähnliche Drähte zum Auflegen auf die Scala, und es hat der eine ein
Gewicht von 1/10, der andere von 1/100 des Gewichtes eines der größeren Drähte.
Wenn man nun den Reiter a über den Senkel hängt, so wird
derselbe einen Zug ausüben, welcher dem Gewichte des destillirten Wassers gleich ist
und deßhalb mit 1,000 bezeichnet werden kann; setzt man ihn dagegen auf den ersten
Theilstrich, so ist sein Zug nur den zehnten Theil so stark und kann mit 0,100
bezeichnet werden. Je nachdem man denselben über einen Theilstrich setzt, wird er
alle Mal die Zahl der Zehntel angeben, welche nöthig sind, um den Senkel unter die
Oberfläche der Flüssigkeit hinabzudrücken, die man untersuchen will. Auf die gleiche
Weise gibt der Draht c die Hundertstel und der Draht d die Tausendstel an.
Der Gebrauch ist nun folgender. Man füllt das Cylindergläschen der Waage bis an den
Diamantstrich mit der Flüssigkeit, welche man wägen will, setzt ferner die Waage
zusammen und hängt den Senkel an, stellt das Gläschen neben den Senkel und zieht das
Stengelchen der Waage so weit heraus, daß der Senkel tiefer steht als die Oberfläche
der Flüssigkeit; endlich ergreift man den Fuß der Waage, hebt dieselbe in die Höhe
und läßt den Senkel in die Flüssigkeit eintauchen, während man die Waage wieder auf
den Tisch stellt. Hierauf setzt man den schwersten Reiter mit seiner scharfen Kante
in die verschiedenen Kerben ein, bis die Marke am Balken horizontal steht; da sich
nun dieses fast nie mit einem einzigen Reiter bewerkstelligen läßt, so stellt man
das vollständige Gleichgewicht durch Auflegen der kleineren Gewichte her. Ist dieses
geschehen, so schreibt man die Zahlen der Theilstriche auf, welche unter den
Reiterchen stehen, und zwar nach der Reihenfolge ihrer Größe, und bekommt hierdurch
eine Gesammtzahl, welche das specifische Gewicht der Flüssigkeit unmittelbar
ausdrückt. Untersucht man z.B. einen Weingeist und muß den Reiter b auf 8, den Reiter c auf 3
und den Reiter d auf 6 setzen, so wiegt der Weingeist
0,836. Treffen zwei Reiter auf den gleichen Strich, so hängt man den kleinen an den
größeren an. Ist die Flüssigkeit schwerer als Wasser, so wird vor Allem der Draht
a an den Haken über den Senkel gehängt, und in
diesem Falle würde, wenn die Reiter wie vorstehend aufgelegt wären, das Gewicht der
Flüssigkeit (etwa einer Säure) 1,836 seyn, statt 0,836. Wenn die Gefäße genug
Halsweite und Tiefe haben, läßt man den Senkel unmittelbar in dieselben eintauchen,
was weit bequemer ist als das Ausfüllen. Sollte in Folge schräger Stellung des
Tisches oder dergleichen der Balken sich (vor dem Wägen) nicht ganz horizontal
stellen, so merkt man sich nur, um wie viel die Marke abweicht, und legt die
Reiterchen so auf, daß der Balken wieder die gleiche abweichende Stellung bekommt,
ehe man die Zahlen abliest. Sehr nothwendig ist auch, daß der Senkel nirgends
anstreift und daß keine Luftbläschen an demselben hängen bleiben.
Der Preis einer solchen Waage, welche in ein Schieberkästchen eingepaßt ist, beträgt
9 fl. 30 kr., wenn ein gewöhnlicher Senkel, und 10 fl., wenn ein Senkel mit
Thermometer beigegeben ist. Diese Aräometerwaagen können von O. Autenrieth's Wittwe in Ulm
fortwährend in sorgfältiger Ausführung bezogen werden.
Tafeln