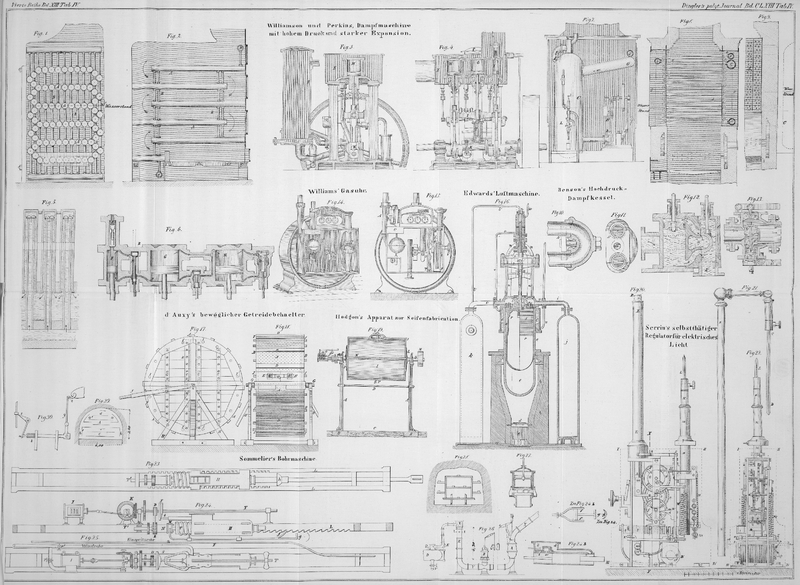| Titel: | Benson's Hochdruckdampfkessel. Nach einem Vortrage von J. J. Russell zu Wednesbury in der Institution of Mechanical Engineers zu Birmingham. |
| Fundstelle: | Band 163, Jahrgang 1862, Nr. LXIV., S. 246 |
| Download: | XML |
LXIV.
Benson's Hochdruckdampfkessel. Nach einem Vortrage von J. J.
Russell zu Wednesbury in der Institution of Mechanical Engineers zu Birmingham.
Aus dem Mechanics'
Magazine, August 1861, S. 68.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Ueber Benson's Hochdruckdampfkessel.
Der im Folgenden beschriebene Dampfkessel ist von Benson
in Cincinnati erfunden und seit 3–4 Jahren in etwa 50 Exemplaren in Amerika
verbreitet. Nachdem der Berichterstatter nunmehr seit 10 Monaten einen solchen
Kessel in Gebrauch hat, ist er in der Lage, folgende Mittheilungen über denselben zu
machen. Der Kessel dient zur Speisung einer Maschine von 60 Pferdekräften, und hat
sich in seiner Construction und Wirksamkeit so bewährt, daß jetzt ein zweiter
größerer errichtet worden ist, bei welchem noch einige Verbesserungen, die sich aus
dem Gebrauche des ersteren ergaben, angebracht worden sind; dieser letztere ist in
Fig.
7–9 dargestellt. Fig. 7 ist ein
Vorderaufriß mit dem Reservoir und der Circulationspumpe; Fig. 8 ein
Längendurchschnitt des Kessels, und Fig. 9 ein hierauf
senkrechter Querschnitt.
Der eigentliche Kessel besteht ganz aus den Röhren A, die
in horizontalen Reihen über dem Feuer angebracht sind. B,
B sind die Thüren an der Vorder- und Hinterwand des Kessels, um die
Röhren befestigen, lösen und herausnehmen zu können. C,
Fig. 7,
ist das Wasser- und Dampfreservoir; D ist die
Circulationspumpe, welche das Wasser aus C saugt und
durch die kleine Maschine E getrieben wird. F ist die Haupt-Speiseröhre von der
Circulationspumpe, mit welcher die untersten Röhren jeder Schichte verbunden sind.
G ist die Hauptabflußröhre, mit welcher die obersten
Röhren jeder Schichte verbunden sind, und in welche Dampf und Wasser aus den Röhren
gelangen, um nach dem oberen Theil des Reservoirs C zu
strömen.
Die Circulationspumpe – in Fig. 12 im Durchschnitt
dargestellt – ist eine einfache direct wirkende Pumpe mit einem mit Metall
geliedertenKolben;
sie hat statt des Saug- und Druckventils ein einziges Schieberventil H, welches weder Voreilen noch Deckung hat, so daß die
Wirkung ebenso zuverläßig wie constant ist.
Die Pumpe saugt das Wasser aus dem Reservoir durch die gewöhnliche
Einströmungsöffnung I, welche um den Cylinder herumgeht,
und treibt dasselbe durch die Ausströmungsröhre K
mittelst der Röhre F in die Siederöhren. Der in diesen
erzeugte Dampf wird mit dem Wasser durch die Röhren in die Höhe getrieben und
gelangt durch die Röhre G in das Reservoir C, worin sich Dampf und Wasser trennen; letzteres wird
durch die Pumpe dann wieder in die Röhren getrieben.
Wenn der Kessel angefeuert wird, füllt man das Reservoir so weit mit Wasser, daß
dieses gleich hoch mit der fünften oder sechsten Röhrenreihe steht (s. d. punktirte
Linie in Fig.
7). Da die Circulationspumpe anfangs bei noch fehlendem Dampfe still
steht, so läßt man den Schieber H, Fig. 12, von seinem Stand
durch den Wasserdruck heben, so daß das Wasser direct, ohne durch die Pumpe hindurch
zu gehen, nach den Röhren fließt. Nach dem Anzünden des Feuers treibt der
entwickelte Dampf die Pumpe.
Die Circulationspumpe treibt mehr Wasser durch die Röhren, als darin verdampft wird.
Die an dem jetzt seit 10 Monaten im Betriebe befindlichen Kessel benutzte Pumpe ist
doppeltwirkend, hat 6'' Durchmesser, einen Hub von 9'' und macht 40 Umdrehungen in
der Minute. Der Widerstand, welchen sie zu überwinden hat, beträgt 7–10 Pfd.
auf den Quadratzoll, und ihre gesammte Betriebskraft 1/2 Pferdestärke. Unter diesen
Verhältnissen treibt sie 9- bis 11mal so viel Wasser durch den Kessel, wie
darin verdampft wird, was nach der Erfahrung mehr als zum größten Effect dienlich
ist, indem 8- bis 9mal die verdampfte Menge als das richtige Verhältniß
gelten kann. Bei der Geschwindigkeit von 40 Umdrehungen ist die Pumpe im Stande,
einen Kessel von 100 Pferdestärken zu bedienen, wenn mit Niederdruck gearbeitet
wird. Wird mit überhitztem Hochdruckdampf und Expansion gearbeitet, so reicht sie
für einen Kessel von 150 Pferdestärken aus, und consumirt in diesem Falle nur 1/3
Proc. oder 1/300 der gesammten vom Dampfe producirten Leistung, und bei der
Anwendung der verbesserten Röhrenkniee, deren Beschreibung weiter unten folgt, ist
wegen des verminderten Widerstandes eine noch geringere Betriebskraft zu erwarten.
Die Pumpe braucht bei einem Dampfdruck von 80 oder 100 Pfd. keine größere
Betriebskraft, als wenn der Druck nur 20 Pfd. beträgt, weil der Druck des Dampfes
gegen beide Flächen des Pumpenkolbens gleich groß und nur der Widerstand des Wassers
in den Röhren, der mit vermehrter Geschwindigkeit wächst, zuüberwinden ist. Das Abflußrohr
G, durch welches Dampf und Wasser aus den Röhren in
das Reservoir abgegeben werden, hatte ursprünglich nur 5 Zoll lichte Weite; man fand
es aber zu eng, und hat ihm deßhalb bei dem neuen Kessel 10 Zoll Weite gegeben. Das
Reservoir C empfängt sein Wasser durch einen Giffard'schen Injector.
Es wurde von vorn herein angenommen, daß die Circulation einer Wassermenge, welche
das 9- bis 11fache der verdampften Wassermenge beträgt, ausreichend sey, um
alle in den Röhren sich bildenden Niederschläge sofort weg zu waschen und also
zugleich die Belästigung durch den Kesselstein zu beseitigen; und dieß ist bis zu
einem gewissen Grade der Fall, insofern alle losen Niederschläge durch das Wasser in
das Reservoir übergespült werden. Eine gewisse Steinbildung findet aber dabei immer
noch statt, doch ist dieselbe nicht so bedeutend, um Schwierigkeiten zu bereiten
oder die Röhren zu beschädigen. Die meisten Niederschläge bilden sich in den
untersten Röhrenreihen; doch können sie sich nicht in einer gefährlichen Dicke
anhäufen, weil sie in Folge der Ausdehnung und Zusammenziehung, welcher die Röhren
unter der wechselnden Temperatur ausgesetzt sind, immer wieder aufspringen und von
der Wand sich ablösen. Von Zeit zu Zeit wird auch alles Wasser aus den Röhren
ausgetrieben, so daß sie sehr heiß – freilich nicht zu heiß – werden,
und wenn sich dann die Niederschläge abgelöst haben, so werden sie mit dem
circulirenden Wasser in das Reservoir übergespült. Der Schmutz und der Stein, welche
sich in dem Reservoir ansammeln, werden durch einen Ausblasehahn, der täglich
drei- bis viermal geöffnet wird, aus diesem entfernt. Es bedarf ungefähr 1/4
Minute, um durch den Ausblasehahn alle im Reservoir angesammelten fremden Körper zu
entfernen; dann besteht der Strahl wieder in einem vollen Wasserkörper. Aus den
Abrundungen der ausgeblasenen Steintheile ergibt sich, daß dieselben in den Röhren
gebildet, dann abgelöst und hierauf in das Reservoir übergeführt worden sind.
Die Verbindung der Röhrenenden unter einander war an den älteren Kesseln dieser
Construction durch rechts- und linksgängige Gewinde ausgeführt, welche an die
Röhrenenden angeschnitten und in die Kniee eingeschraubt waren; allein bei dieser
Verbindung mußte jedesmal eine ganze Röhrenabtheilung herausgenommen werden, wenn
eine einzige Röhre ausgewechselt werden sollte. Bei großen Kesseln macht dieß,
abgesehen von der Schwierigkeit der Handhabung und der Zugänglichkeit, zu viel
Störung. Bei dem neuen Kessel ist deßhalb eine andere Verbindungsweise, welche das
Herausnehmen einzelner Röhren gestattet, in Anwendung gebracht worden. Diese
verbesserten Kniee zeigen Fig. 10 und 11. An den Röhrenenden
befinden sich angeschweißte Bundringe, und die Enden der Kniee haben dagegen
entsprechende Vertiefungen. Die Kniee werden nun gegen die Bundringe der Röhren
durch einen Schraubenbolzen M angezogen, welcher durch
eine Bohrung im Knie hindurchgeht, und in der Mitte zwischen den beiden Röhren
liegt. Das Gewinde des Schraubenbolzens geht in einer Platte N, welche sich gegen die inneren Flächen der Bundringe anlegt. Die
Durchgangsöffnung des Kniees ist zur Seite des Befestigungsbolzens ausgebogen, damit
der Querschnitt derselben nicht verengt wird. Bei dieser Einrichtung können die
einzelnen Röhren durch die am vorderen und hinteren Ende befindlichen Thüren B beliebig herausgenommen und ausgewechselt werden. Die
Enden der Röhren gehen durch die Röhrenplatten hindurch, welche die gußeisernen
Kniee gegen die unmittelbare Einwirkung des Feuers schützen, und entweder auf dem
Mauerwerk des Ofens aufruhen, oder oben an Tragbalken Q
aufgehängt sind. Die Verbindung zwischen den Röhren und dem Reservoir läßt sich
durch Ventile aufheben, so daß Wasser und Dampf, so lange eine Reparatur dauert, im
Reservoir zurückgehalten werden können.
Der hauptsächliche Vortheil dieses Kessels besteht darin, daß in demselben
Hochdruckdampf mit größerer Sicherheit erzeugt wird, als in den gewöhnlichen Kesseln
niedrig gespannter Dampf. Das Reservoir C ist der
einzige Theil des Kessels, welcher so viel Dampf enthält, daß durch denselben eine
Explosion veranlaßt werden könnte; er hat deßhalb, um dem Dampfdruck möglichst
kräftig zu widerstehen, eine möglichst einfache Gestalt, die zugleich die größte
Sicherheit gewährt, und ist der Einwirkung des Feuers entzogen. Die schädlichen
Einflüsse der übermäßigen Erhitzung und der wechselnden Temperatur, welche sonst
gewöhnlich die Beschädigungen und Explosionen der Kessel veranlassen, sind dadurch
gänzlich beseitigt. Nur das Röhrensystem ist dem unmittelbaren Feuer ausgesetzt; die
Röhren haben aber einen so kleinen Fassungsraum, daß eine etwaige Explosion keinen
Schaden verursacht, sondern höchstens durch das auslaufende Wasser das Feuer
verlöscht. Es hat sich dieß bereits an einem Kessel des Berichterstatters bestätigt.
Als während des Betriebes von Kessel und Maschine eine Röhre zersprang, war die
Wirkung hiervon so unbedeutend, daß man den Vorfall nicht einmal sogleich bemerkte,
sondern erst durch die sinkende Dampfspannung und das in das Feuer niederfallende
Wasser aufmerksam gemacht wurde.
Wesentlich eigenthümlich ist dieser Kesselconstruction die Anwendung der
Circulationspumpe, durch welche eine ununterbrochene und regelmäßige Circulation des
Wassers in dem die Heizfläche des Kessels bildendenRöhrensystem unterhalten
wird.Dieses Princip wurde bereits von J. Fr. Spencer
angewandt; man s. die Beschreibung seines Hochdruckkessels im polytechn.
Journal Bd. CLVII S. 241. A. d. Red. Dieses Princip der künstlich erzeugten Wassercirculation gibt erst dem
Röhrenkessel seinen vollständigen Erfolg, weil er, in Verbindung mit der
Circulation, bei dem kleinsten Aufwand von Material das größte Maaß von Sicherheit
gewährt, während bei der natürlichen Circulation der Dampf sich viel zu rasch bilden
und das Röhrensystem durch die Hitze zerstört werden würde. Man kann der künstlichen
Wassercirculation den Vorwurf machen, daß der Betrieb des Kessels von ihr abhängig
ist, und daher durch sie gestört werden kann; es ist jedoch noch nie eine hierdurch
veranlaßte Störung vorgekommen, was wohl hauptsächlich der Einfachheit der
Pumpenconstruction zu verdanken ist. Während der 10 Monate, in welchen der Kessel
ununterbrochen im Gange war, hat die Circulationspumpe stets gut gearbeitet, und
wenn Störungen vorkamen, so waren sie nur durch äußere Veranlassungen herbeigeführt,
wie z.B. im verflossenen Winter durch Einfrieren des Wassers. Beim Anlassen macht
der Umstand, daß die Circulationspumpe noch nicht im Betriebe ist, gar keine
Schwierigkeit, weil vor Beginn der Dampfbildung das Wasser in den Röhren nicht zu
circuliren braucht, die Pumpe selbst aber bei ihrer geringen Betriebskraft mit der
beginnenden Dampfbildung sogleich in Thätigkeit gesetzt werden kann.
Ein anderer Vortheil des Kessels besteht darin, daß er leicht transportabel ist. Das
größte Stück, das Reservoir, ist nur 1/10mal so groß als ein gewöhnlicher, für
Erzeugung einer gleichen Dampfmenge bestimmter Kessel, und die Röhren können
bündelweise verpackt werden. Man hat daher nicht nur ein viel geringeres Gewicht,
sondern auch ein geringeres Volumen zu transportiren. Die Raumersparniß, welche der
aufgestellte Kessel gewährt, ist ebenfalls sehr bedeutend; er nimmt nur 1/6 bis 1/4
des Raumes ein, den ein Cornischer von gleicher Stärke braucht.
Die Kosten solcher Kessel betragen, wenn ihre Stärke 25 Pferdestärken überschreitet,
eingerechnet die Circulationspumpe und die Armatur, wenig mehr als die der
gewöhnlichen Kessel, weil viele Theile mehrmals vorkommen. Kleinere Kessel kosten
freilich verhältnißmäßig mehr, weil man immer die Pumpe haben muß, die in kleineren
Dimensionen beinahe eben so viel kostet als in größeren. Bei diesem Vergleich ist
angenommen, daß der Dampfdruck 25 bis 50 Pfund auf den Quadratzoll beträgt. Da aber
der neue Kessel besonders für hohe Spannungen von 100 bis 150 Pfund bestimmt ist, so
werden die Anlagekosten, auf die Pferdestärke bezogen, noch viel billiger. Und in
allen Fällen wird der Transport und die Aufstellung billiger. Die durchschnittliche
Dicke der Kesselröhrenbeträgt nicht über 1/8 Zoll, und da ihre gesammte Oberfläche als directe
Heizfläche wirkt, so kann man hieraus abnehmen, wie viel an Gewicht gegen die
gewöhnlichen Kessel mit 3/8 bis 1/2 Zoll Dicke erspart wird. Endlich muß noch darauf
aufmerksam gemacht werden, daß an Kesseln dieser Art Reparaturen sich sehr leicht
vornehmen lassen.
Dampf und Wasser werden zwar gemeinschaftlich aus dem Röhrensystem in das Reservoir
übergeführt, allein sie werden doch vollständig von einander getrennt, und der Dampf
strömt völlig trocken ab. Hiervon hat man sich dadurch überzeugt, daß man oberhalb
und unterhalb des Abflußrohres G im Reservoir
Abblasehähne anbrachte, wobei man fand, daß durch den oberen Hahn nur Dampf und
durch den unteren nur Wasser ausströmte. Diese vollständige Absonderung des Wassers
vom Dampf hat ihren Grund darin, daß das Reservoir der directen Einwirkung des
Feuers nicht ausgesetzt ist, und der Wasserspiegel in demselben fast ganz ruhig
bleibt. Zugleich kann der Dampf in diesem Kessel überhitzt werden, indem man ihn aus
dem Reservoir durch das Rohr R nach dem oberen Theile
des Feuerraumes in das Röhrensystem S leitet, aus dem er
dann durch das Rohr T nach der Maschine abströmt. Die
Ueberhitzungsröhren S sind in gleicher Weise angeordnet
und mit einander verbunden, wie die für die Dampfbildung bestimmten Röhren A.
Dieser Kessel verdampft, mit Kleinkohle von Staffordshire geheizt, 5 1/2 Pfund Wasser
mit 1 Pfund Kohle, wobei das Reservoir und die Dampfleitungsrohre noch nicht gegen
äußere Abkühlung geschützt sind. Vom ersten Anfeuern an wird binnen 25 Minuten Dampf
von 10 Pfd. Spannung erzeugt und die Circulationspumpe in Gang gesetzt, 10 Minuten
später beträgt die Dampfspannung 35 Pfund, und die Maschine wird in Gang gesetzt,
und noch 10 Minuten später, also im Ganzen 45 Minuten nach dem ersten Anfeuern,
arbeitet die Maschine mit ihrer vollen Kraft. Die Heizfläche betrug bei dem
Versuche, der zur Ermittelung dieser Werthe besonders angestellt wurde, 460
Quadratfuß, d.h. nur 7/10 der gesammten Heizfläche, und 3/10 waren außer Thätigkeit
gesetzt. In der Mittagszeit und zu anderen Zeiten, während welcher die Maschine
stillsteht, schließt man das Register, öffnet die Feuerthüre, bedeckt das Feuer mit
Asche und Kohlenklein, und erhält die Circulationspumpe in einem so langsamen Gang,
als es nur die Construction derselben gestattet; dadurch wird die Dampferzeugung
unterbrochen, und zugleich werden die Röhren gegen übermäßige Erhitzung geschützt.
Soll dann die Maschine wieder in Gang gesetzt werden, so wird 5 bis 10 Minuten
vorher das Feuer geschürt und mit frischen Kohlen gespeist; dieß genügt, um für den
vollen Gang der Maschine wieder regelmäßig die gehörige MengeDampf zu erzeugen. Die
Dampfspannung kann übrigens in diesen Kesseln nicht mit derselben Gleichmäßigkeit
auf einer gewissen Höhe erhalten werden, als in den gewöhnlichen Kesseln, weil der
Dampfraum verhältnißmäßig klein ist; doch ist die Gleichmäßigkeit, welche erzielt
werden kann, immer noch für alle praktischen Zwecke ausreichend.
Um sicher zu seyn, daß die Spannung, mit welcher der Dampf der Maschine zuströmt,
eine gewisse Grenze niemals übersteige, und um zu verhindern, daß der Maschine aus
einer durch den kleinen Dampfraum hervorgerufenen, übermäßigen Spannung eine Gefahr
erwachse, hat der Berichtstatter das (im polytechn. Journal Bd. CLXII S. 1
beschriebene) Regulirungsventil Z, welches seinem Zweck
vollständig entspricht, in die Leitung eingeschaltet.
Tafeln