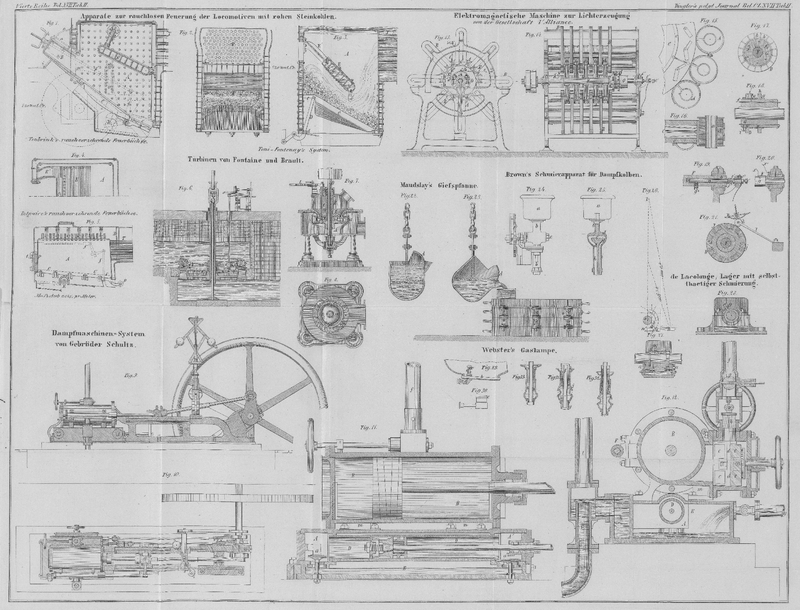| Titel: | Zapfenlager mit selbstthätiger Schmierung, von Ordinaire de Lacolonge. |
| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XXII., S. 98 |
| Download: | XML |
XXII.
Zapfenlager mit selbstthätiger Schmierung, von
Ordinaire de Lacolonge.
Aus Armengaud's
Génie industriel, Juli 1862, S. 21.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
de Lacolonge's Zapfenlager mit selbstthätiger
Schmierung.
E. Bourdon hat im J. 1857 (polytechn. Journal Bd. CXLIV S.
168) ein Zapfenlager mit selbstthätiger Schmierung angegeben, bei welchem das von einer
Schmierscheibe aufwärts geführte Oel von einem Abstreicher gefaßt und den zu
schmierenden Flächen zugeführt wird. Die Scheibe bringt aber bei sehr langsamer
Bewegung so wenig Oel mit, daß es fraglich erscheint, ob dasselbe noch von der
Welle, auf welche es abgestrichen wird, bis zum Zapfen zu gelangen vermag, was den
Erfinder veranlaßte, für kleine Geschwindigkeiten die Construction der Lager mit
selbstthätiger Schmierung etwas abzuändern.
In Figur 26
sey a b c d eine kleine Zelle, welche mit der
horizontalen Welle O fest verbunden ist und bei jeder
Umdrehung der Welle unter das Niveau eines Oelbehälters n,
n' taucht. Wenn die Welle in Bewegung ist, so enthält die Zelle immer dann
das meiste Oel, wenn die Kante a im Niveau des
Oelspiegels liegt, vorausgesetzt daß das Oel in seinem Behälter in Ruhe und die
Centrifugalkraft so gering ist, daß das Oel in der Zelle und im Behälter in gleichem
Niveau sich befindet.
Zur Bestimmung des Krümmungshalbmessers, nach welchem der Wasserspiegel in einem
Wasserrade sich einstellt, dient bekanntlich die Formel OI = 894,6/N², wenn N die Umdrehungszahl in der Minute bezeichnet. Diese
Formel ist auch in unserem Falle anwendbar. Die größte Abweichung von der
Horizontalen bewegt sich immer noch in den Bruchtheilen eines Millimeters, wenn man
OI = 1 Meter setzt; und hiefür ist N = 1/894,6 = 29,91, also in runder Zahl 30. Setzt man
die Entfernung Oa = 90 Millim., so beträgt für N = 30 die Umfangsgeschwindigkeit 0,283 Meter. Bei
dieser Geschwindigkeit ist der Oelspiegel fast ohne Bewegung, und bei 0,236 Meter
Umfangsgeschwindigkeit, was 25 Umdrehungen entspricht, ist nach den hierüber
angestellten Versuchen gar keine Bewegung desselben mehr vorhanden.
Hiernach muß man die Umfangsgeschwindigkeit auf 0,24 Meter beschränken. Bei kleineren
Durchmessern könnte man allerdings N größer als 30
machen; allein es ist doch nothwendig, der Zelle so viel Fassungsraum zu geben, daß
immer eine für die Schmierung hinreichende Menge Oel in derselben enthalten ist.
Untersucht man jetzt den Vorgang beim Aufsteigen der Zelle. Da der Oelspiegel in der
Zelle horizontal steht, so kann, sobald die Fläche ac über das Niveau nn
' herausgetreten ist, nach Außen kein Oel mehr
abfließen. Wenn aber die Steigung so weit fortgeschritten ist, daß die Kante b unter den Oelspiegel zu liegen kommt, so fängt das Oel
an nach innen abzufließen.
Das ausfließende Oel ist drei Kräften unterworfen, von denen jede ihm eine in ihrer
eigenen Richtung wirkende Geschwindigkeit ertheilt. Die eine dieser
Geschwindigkeiten ist die Drehungsgeschwindigkeit der Zelle und wirkt tangential;
die zweite geht aus der Schwerkraft hervor und wirkt vertical, und die dritte, eine
Folge der Centrifugalkraft, wirkt radial. Nachdem man nun durch Versuche den Punkt,
bei welchem die Zelle auszugießen beginnt, gefunden hat, verbindet man denselben mit
dem Mittelpunkt und mißt den Winkel, welchen dieser Halbmesser mit der verticalen
Richtung einschließt. Hieraus erhält man zugleich die Winkel, welche die
verschiedenen Geschwindigkeiten mit einander einschließen. Darauf zerlegt man die
Geschwindigkeiten nach horizontaler und verticaler Richtung, vereinigt dieselben
wieder und leitet nun hieraus die Curve ab, nach welcher das von der Kante b abfließende Oel sich bewegt. Man untersucht nun, ob
diese Curve die Welle trifft. Wiederholt man die Construction für mehrere Punkte, so
kann man auf diese Weise die äußersten Stellungen der Zelle bestimmen, in welchen
das ausfließende Oel die Welle trifft. Man kann dann immer leicht die Neigung der
Zelle gegen den Radius derart verändern, daß das Ausgießen nicht zu zeitig beginnt
und möglichst viel Oel der Welle zugeführt wird.
Ist das Oel auf diese Weise zur Welle gelangt, so ist es noch dem Zapfen zuzuführen.
Dieß geschieht dadurch, daß man die Zelle nach Art der Zellen an den Schöpfrädern
ausführt.
Auf Grund dieser Betrachtungen ist die Lagerconstruction entstanden, welche in Fig. 27 und
28 in
zwei Durchschnitten abgebildet ist. Oelkammer und Lagerbock bestehen aus Gußeisen
und sind aus einem Stück gegossen; durch den Lagerbock zerfällt die Oelkammer in
zwei Abtheilungen, welche durch die Durchbrechung im Bock mit einander in Verbindung
stehen. In den Seitenflächen der Oelkammer befinden sich kreisförmige Oeffnungen,
durch welche die Welle hindurch gelegt wird, mag sie nun in dem Lager endigen oder
durch dasselbe hindurch fortgesetzt seyn. Diese Oeffnungen erleichtern zugleich das
Putzen der Durchbrechung im Bock nach dem Guß und die Bearbeitung der Fläche, auf
welche das Lagerfutter aufgesetzt wird. Vor der Ingangsetzung werden die Oeffnungen
durch einen Deckel aus starkem Leder, welcher vermittelst eines aufgeschraubten
eisernen Halbringes gegen die Wandfläche der Kammer angedrückt wird, verschlossen.
An der Welle ist das Leder so viel ausgeschnitten, daß zwischen beiden ein kleiner
Spielraum bleibt.
Der Lagerdeckel ist so geformt, daß er mit einem Vorsprung bis unter die Zelle g reicht, und über diesem Vorsprung befindet sich eine
becherförmige Höhlung, durch welche das Oel den Zugang zum Zapfen findet. Das in dem
Becher sich ansammelnde Oel kann noch durch einen zweiten Canal zum Zapfen
gelangen und trifft hier zugleich den Anlauf des Zapfens.
Bei höchstens 30 Umdrehungen braucht man nicht zu befürchten, daß das Oel aus dem
Lager herausspritzt, und es wäre daher aus diesem Grunde eine Bedeckung des Lagers
nicht nothwendig. Trotzdem ist es, und zwar zur Abhaltung des Staubes, zweckmäßig
einen leichten Deckel aus Kupfer oder Zink anzuwenden. Dieser Deckel sitzt in zwei
Furchen, welche in den gußeisernen Lagerbock eingeschnitten sind, und auf den
viereckigen Köpfen der Schrauben, durch welche das Leder festgehalten wird. Zum
leichteren Regieren des Deckels kann man denselben mit Handhaben versehen.
Die Zelle g sitzt vermittelst eines Armes an einem Ringe,
welcher auf die Welle aufgekeilt ist, und besteht aus Messing. In der Bodenplatte
befindet sich eine Rinne mit geringer Neigung, durch welche das Oel abgelassen
werden kann; die Oeffnung ist für gewöhnlich durch einen Kork verschlossen. Das in
der Abbildung dargestellte Lagermodell eignet sich für Wellen von bis zu 100 Millim.
Stärke.
Ein Paar solcher Lager für 60 Millim. Zapfenstärke arbeiten seit Februar 1862 bei
Gebrüder Cousin in Bordeaux, und zwar vollkommen
zufriedenstellend. Es hat sich ergeben, daß in den Grenzen von 12 bis 30 Umdrehungen
die Neigung der Zelle gegen den Radius mit der Geschwindigkeit verändert werden muß;
bei 90° und 30 Umdrehungen fiel allerdings schon ein großer Theil des Oels
neben den Becher, aber derselbe nahm doch immer noch mehr auf, als zur Schmierung
nothwendig war. Der Stand des Oelspiegels in der Kammer hat natürlich auch einen
Einfluß auf die Menge des von der Zelle aufgenommenen Oels und den Punkt, bei
welchem das Ausgießen beginnt. Man konnte aber dieses Niveau um 20 Millim. senken,
ohne daß hierdurch die Schmierung im mindesten beeinträchtigt wurde. Eine Erneuerung
des Oels war bei Cousin nach zwei Monaten noch nicht
nothwendig.
Tafeln