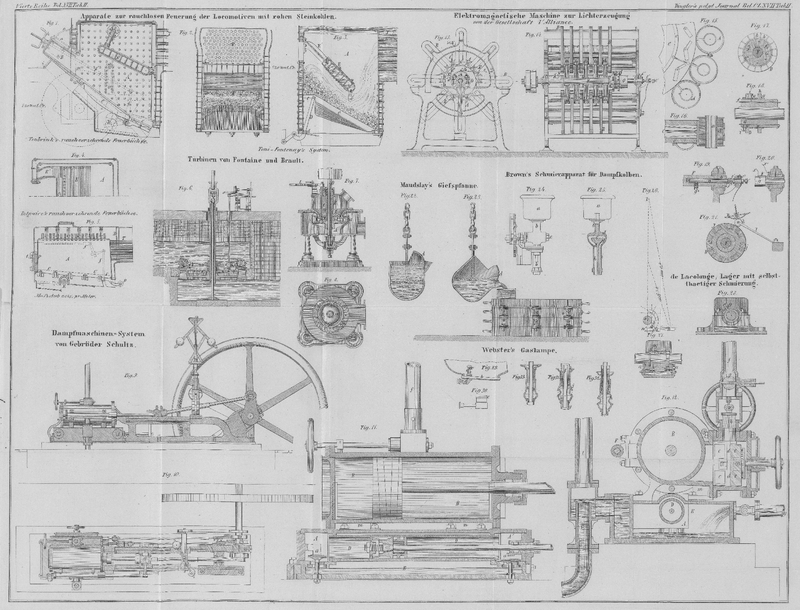| Titel: | Verbesserungen an Gaslampen, von J. Webster in Birmingham. |
| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XXIII., S. 102 |
| Download: | XML |
XXIII.
Verbesserungen an Gaslampen, von J. Webster in Birmingham.
Aus dem London Journal of
arts, October 1862, S. 214.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Webster's Verbesserungen an Gaslampen.
Diese Verbesserungen (patentirt in England am 4. Februar 1862) beziehen sich
einestheils auf die Brenner selbst, anderntheils auf die Schieber der beweglichen
Hängelampen.
Die Löcher der verbesserten Brenner werden so gebohrt, daß die Flamme nach abwärts
austritt und dann sauft in Gestalt eines Pilzes aufsteigt. Beim Argandbrenner werden
diese Löcher in einem den eigentlichen Brenner umgebenden Ring und nicht in der
oberen Fläche angebracht; es kann somit die Luft unmittelbar auf das austretende Gas
einwirken, wodurch eine vollkommenere Verbrennung erzielt wird. Die verbesserten
Schieber dienen als Ersatz der bisher bei den hydraulischen Verschlüssen
angewendeten Ketten und Gegengewichte.
Fig. 29
stellt einen verbesserten Schlitzbrenner, Fig. 30 einen
Argandbrenner dar; in Fig. 31–33 sind
verschiedene Modificationen des verbesserten Schiebers abgebildet.
a, Fig. 29, ist ein
einfacher Fledermausbrenner; er ist auf dem inneren Rande der Gallerte oder des
Glasträgers b und nicht in der Mitte (wie die
gewöhnlichen Brenner) angebracht. Die Oeffnung für das Gas ist bei c in Form eines Schlitzes in einer sanft gegen die Mitte
des Brenners aufsteigenden Richtung eingeschnitten; die Flamme tritt daher als eine
flache Zunge nach unten aus, so daß sie unter dem Einfluß des durch die Gallerte
stattfindenden Zuges aufwärts getrieben und in fast horizontaler Richtung erhalten
wird. Um die Berührung der Flamme mit dem Glase zu verhindern (wenn ein Glas
nothwendig ist), gibt man diesem die dargestellte Form, so daß, wenn die Gallerie
zur Aufnahme desselben groß genug ist, man kein Zerbrechen zu befürchten hat. Die
Schlitze sind in den Seiten des Brenners und nicht in dem vorderen Ende des Rohres
eingeschnitten, so daß die Flamme nahezu einen rechten Winkel mit dem Rohre d bildet. Um das Flackern der Flamme zu verhindern, muß
bei einem derartigen Brenner der Gasstrom vor dem Austritt getheilt werden; deßhalb
ist der Brenner innerlich durch eine vertical angebrachte Metallscheidewand in zwei Abtheilungen
getrennt, welche zwei halbkreisförmige Canäle bilden.
Fig. 30
stellt einen derartigen Argandbrenner dar, bei welchem die Oeffnungen seitlich bei
e, e angebracht sind, und zwar in kurzer Entfernung
von dem Rande, wodurch ein früherer Contact des Gases mit der Luft und mithin eine
vollkommenere Verbrennung desselben erzielt wird.
Fig. 31
stellt einen Durchschnitt des Schiebers für bewegliche Hängelampen dar, wobei die
Anwendung, von Ketten, Gegengewichten und Rollen umgangen wird.
f ist das feste Gaszuleitungsrohr, g das hydraulische Schieberohr; h ist das Wassergefäß, an welchem die Stopfbüchse j angebracht ist, die inwendig mit einem Gewinde zur Aufnahme der
Schraubenkappe k versehen ist. l ist ein metallener Mantel, dessen Enden entweder übergreifend oder nicht
ganz zu einer Röhre geschlossen sind, so daß er sich frei ausdehnen und
zusammenziehen kann. Dieser Mantel umgibt die Röhre f
und wird seinerseits von dem dicken Stück vulcanisirten Kautschuks m umgeben, welches als Feder wirkt, und den Mantel mit
einem gewissen Schluß an das feste Rohr andrückt. Dieser Schluß wird durch jede
weitere Drehung der Schraubenkappe k vermehrt, welche
den Kautschuk in senkrechter Richtung zusammenpreßt und ihn so zwingt, seine Kraft
in horizontaler Richtung auszuüben und den Mantel fester an das feste Rohr
anzudrücken. Dadurch wird die Reibung stark genug, um das erforderliche Gewicht
tragen zu können. Es wirkt also die Schraubenkappe k als
Regulator für die Stärke des Schiebers je nach dem zu tragenden Gewichte.
Fig. 32 ist
eine Modification der Hängelampe, wobei der Mantel und Kautschukring durch zwei
Metallfedern o ersetzt sind, deren jede ein ledernes
oder anderes Polster p hat. Diese Federn haben einen
fast halbkreisförmigen Querschnitt und sind lose an einen Ring r innerhalb der Stopfbüchse befestigt. Auch hierbei
wirkt die Schraube von k als Regulator: je tiefer sie
eingeschraubt wird, ein desto größeres Stück des Polsters drückt gegen das feste
Rohr und desto größer wird also die Reibung.
Das gleiche Resultat ergibt die Einrichtung Fig. 33, wobei die
Stopfbüchse eine conische Schraube s enthält, während
die Kappe eine cylindrische, aber aufgeschlitzte Schraube führt, so daß sie sich in
einem gewissen Verhältniß zusammenziehen kann. Wenn diese Kappe niedergedreht wird,
so muß sie in der conischen Schraube zusammengedrückt und so an das feste Rohr
angepreßt werden, daß eine zum Tragen der Lampe ausreichende Reibung entsteht.
Tafeln