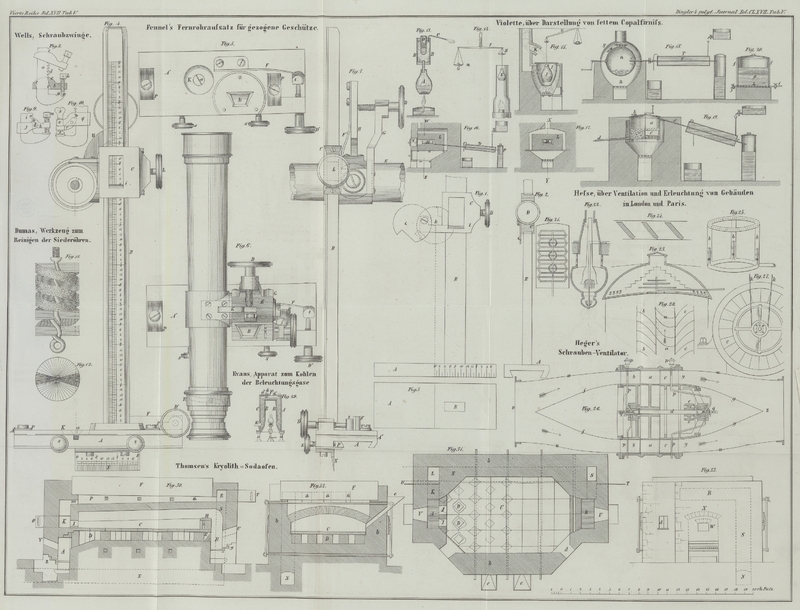| Titel: | Neue Darstellung der fetten Copalfirnisse; von H. Violette in Lille. |
| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. XCVII., S. 371 |
| Download: | XML |
XCVII.
Neue Darstellung der fetten Copalfirnisse; von H.
Violette in Lille.Ein Auszug dieser Abhandlung wurde bereits S. 70 in diesem Bande des polytechn. Journals mitgetheilt.
Aus dem Bulletin de la
Société d'Encouragement, November 1862, S. 643.
Mit Abbildungen auf Tab.
V.
Violette's Darstellung der fetten Copalfirnisse.
Die Firnißfabrication ist jetzt noch eine handwerksmäßige Kunst und keine
Wissenschaft; der Verf. beabsichtigt daher die unsicheren Verfahrungsweisen der
Praxis durch bestimmte Vorschriften zu ersetzen, welche den Erfolg sicherstellen und
die Benachtheiligung der Gesundheit bei dieser Fabrication verhüten. Der Hauptzweck
der betreffenden Untersuchungen des Verfassers ist die Herstellung des fetten
Copalfirnisses, wozu man die beiden Varietäten des Copals, den harten und den halbharten
anwendetDer harte Copal kommt aus Calcutta oder Bombay; ersterer ist der
vorzüglichere. Der halbharte Copal ist afrikanischen Ursprungs. Die dritte Varietät, den weichen Copal, wendet
man, seiner geringeren Widerstandsfähigkeit wegen, nur zu medicinischen Zwecken
an.
Trotz der ahlreichen Versuche von Seite der Chemiker und Praktiker kennt man kein
directes Lösungsmittel für den halbharten und den harten Copal. Man muß ihn, bevor
er in dem Gemisch von Oel und Terpenthinöl löslich wird, welches man in der
Firnißfabrication anwendet, durch die Hitze zersetzen. In der Regel aber wendet man
diese Hitze ohne bestimmte Regel an und benachtheiligt dadurch das Harz häufig. Der
Verf. hat sich daher bemüht die Wärmegrade genau festzustellen, bei welchen der
Copal so zersetzt wird, daß er in dem Lösungsmittel löslich wird, ohne jedoch seine
Farbe und seine sonstigen ursprünglichen Eigenschaften mehr als nothwendig zu
verändern. Er fand folgende Zahlen:
Schmelzung.
Destillation.
Harter Copal
340°C.
360°C.
Halbharter Copal
180°C.
230°C.
Diese thermometrischen Grenzen sind in Folge der Verschiedenheiten der Handelswaare
nicht als unveränderlich oder absolut zu betrachten, sondern nur als
durchschnittliche Mittelzahlen für die Praxis, und entsprechen der allergeringsten
Aenderung in der Farbe des Copals.
Die in Rede stehenden Copale lösen sich, nach dem bloßen Schmelzen, weder in der
Kälte noch in der Wärme im Terpenthinöl auf; diese Löslichkeit hängt vielmehr von
einem gewissen Zersetzungsgrade ab, wie sich aus den Versuchen ergibt, welche in
nachstehender Tabelle zusammengestellt sind. Der zu diesen Versuchen angewandte
Apparat bestand aus einer kleinen gläsernen Retorte für den zu schmelzenden Copal
(aus Calcutta); sie tauchte in ein Zinnbad von ungefähr 360°C. und war mit
einer kleinen Kühlvorrichtung verbunden, worin die entwickelten Dämpfe sich als eine
klare gelbliche Flüssigkeit (Copalöl) condensirten.
Textabbildung Bd. 167, S. 373
Nr. des Versuchs; Gewicht des
Copals; vor der Destillation; nach der Destillation; Verlust in Procenten des
Copals; Menge des condensirten Oels; Löslichkeit des destillirten Copals in
Terpenthinöl; Gramme; Unlöslich; Deßgl.; Etwas löslich.; Leichter löslich.; Sehr
löslich.
Alle diese Copale sind wenig gefärbt, die ersteren sehr wenig, die letzteren, längere
Zeit erhitzten, mehr.
Um die Löslichkeit im Terpenthinöl zu bestimmen, wurde eine Reihe von Versuchen unter
Anwendung des in Fig. 13 dargestellten Apparates ausgeführt. Dieser besteht aus der
Glasflasche A mit Wasser und etwas Schrot; eine
untergesetzte Lampe erhitzt das Wasser zum Kochen; der Dampf tritt in das durch zwei
Korke verschlossene Glasrohr B, in welches die kleinere
Röhre D und das Dampfabzugsrohr C eingesetzt sind. In D befindet sich das
Gemisch von Lein- und Terpenthinöl, so wie ein kleines Sieb zur Aufnahme der
bestimmten Menge Copal, welcher also ebenso wie das Lösungsmittel einer constanten
Temperatur von 100°C. ausgesetzt wird.
Die halbharten Copale verhalten sich ebenso wie die harten und die
Lösichkeitsbedingungen sind ungefähr dieselben.
Nach obiger Tabelle kann man annehmen, daß die Copale in dem erwähnten Gemische erst
dann löslich werden, wenn sie 20 bis 25 Proc. ihres Gewichtes durch die Destillation
verloren haben. Ueber 25 Proc. hinaus werden sie immer löslicher, aber auch immer
dunkler und liefern deniger Ausbeute an Firniß, wegen des vorherigen größeren
Verlustes. Die geringste Färbung entspricht dem niedrigsten erforderlichen
Temperaturgrad, nämlich etwa 360°C. Hieraus folgt die Nothwendigkeit de
Erhitzung der Copale auf diesen Punkt und eines Verlustes von 25 Proc. ihres
Gewichtes.
Irdessen ist zu erwähnen, daß Copal, welcher 10 Proc. seines Gewichtes durch
Destillation verloren hat und weder in gewöhnlichem, noch in sorgfältig durch Mischung mit
hygroskopischen Substanzen entwässertem, noch auch in wiederholt rectificirtem
Terpenthinöl löslich ist, sich sehr leicht in solchem Terpenthinöl auflöst, welches
durch längere Einwirkung von Luft und Licht verdickt ist. Wenn man also diese noch
unerklärte Erscheinung durch irgend ein rascher wirkendes Mittel hervorbringen
könnte, welches leicht anwendbar und nicht zu theuer wäre, so würde man dadurch die
Firnißfabrication erheblich fördern.
Neue Methode für die Darstellung des fetten Firnisses.
– Damit man sich die Nachtheile vergegenwärtigen kann, welche dieses neue
Verfahren vermeidet, beschreibt der Verf. das ältere. Bei
demselben werden angewandt:
Harter oder halbharter Copal
3
Kil.
Terpenthinöl
4–5
„
Leinöl
1,50
„
Der Copal wird über freiem Feuer in einem kupfernen Kolben geschmolzen, dann das Oel
und nach gehöriger Vermischung das Terpenthinöl vorsichtig zugesetzt. Dabei sind
besondere Vorsichtsmaßregeln und lange Erfahrung nothwendig; der Erfolg ist auch
nicht selten unbefriedgend. Von den zahlreichen Unannehmlichkeiten sind zu erwähnen:
de Ströme dicken und scharfen Dampfes, welche die Luft verpesten, die großen
Verluste an verdampfendem Terpenthinöl (da dieses in eine siedende Mischung gegossen
wird) und die Feuersgefahr.
Das neue Verfahren, welches in rationeller Weise an Stelle
der alten Praxis treten soll, besteht darin, daß man 1) den Copal bei 360°C.
schmilzt und ihn 20–25 Proc. seines Gewichtes verlieren läßt, und 2) ihn nach
der Schmelzung in einem passenden Gemisch von Leinöl und Terpenthinöl bei
100°C. auflöst.Man löst bei 100°C. auf, um die Operation zu beschleunigen; die Lösung
geht aber auch in der Kälte leicht von statten.
Die Schmelzung des Copals bei genau 360°C. ist eine sehr schwierige Operation.
Im Kleinen und im chemischen Laboratorium ist sie aber licht ausführbar und der
Verf. beschreibt daher zunächst das Verfahren hiebei, wozu er sich des Apparates
Fig. 14
bediente.
E ist ein kleiner Glaskolben, in welchen man 1 Grm.
gepulverten harten Copal bringt, und den man an der einen Seite der Waage F aufhängt, um ihn dann durch die Tara G ins Gleichgewicht zu bringen. Letzteres stört man dann
wieder durch das Gewicht von 0,25 Grm. in der Schale H;
hierauf senkt man den Kolben frei in den Cylinder einer passend regulirten Lampe. Der
Copal schmilzt, destillirt und stößt Dämpfe aus; nach und nach steigt er in die
Höhe, und wenn die Waage im Gleichgewicht steht, hat er ein Viertel seines Gewichtes
verloren. Er ist dann vollkommen löslich und gibt, nach dem Eingießen von 2
Kubikcentimeter Terpenthinöl und 1 Kubikcent. Leinöl in den Kolben, einen
vorzüglichen Firniß.
Um die Versuche in größerem Maaßstabe auszuführen, kann man sich des Apparates Fig. 15
bedienen.
I ist ein irdener Schmelztiegel von 2 Decimeter
Durchmesser und 3 Decim. Höhe; man erhitzt ihn in einer gewöhnlichen Feuerung bis
zum dunkeln Rothglühen, so daß hineingeworfene Zinkkörner schmelzen, Antimon aber
nicht schmilzt.
J ist ein Glaskolben mit flachem Boden, welcher 300
Gramme gepulverten harten Copal enthält und, wie bei dem vorhin beschriebenen
Versuche, an einer Waage aufgehängt ist. Man bringt ihn frei in den erhitzten
Tiegel, welchen man mit einem durchbohrten Deckel verschließt. In die eine
Waagschale legt man eine Tara zur Herstellung des Gleichgewichtes, in die andere,
dem Kolben entsprechende, aber 75 Gramme, also ein Viertel des Copalgewichtes.
Die Dämpfe, welche sich nach dem Schmelzen des Copals entwickeln, gehen durch K in den Kamin; man kann sie auch anzünden und so an der
Kolbenmündung eine hellleuchtende Flamme erzeugen. Nachdem der Copal ein Viertel
seines Gewichtes verloren hat, steigt der Kolben in die Höhe und verläßt von selbst
den heißen Tiegel.
Man läßt nun den Copal sich verdicken, überzieht damit die innere Wandung des Kolbens
und gießt in diesen, während er noch lauwarm ist, 450 Grm. Terpenthinöl und 150 Grm.
Leinöl; man erhält dann einen schönen Firniß; das Terpenthinöl muß vorher entwässert
und das Leinöl trocknend gemacht worden seyn.
Zur Fabrication des Firnisses im Großen schlägt der Verfasser die Anwendung der in
Fig. 16
und 17 nach
zwei Verticalebenen im Durchschnitt dargestellten und von ihm geprüften Apparate
vor:
L Block von Gußeisen, etwa 150 Kilogr. schwer, über dem
Rost eines gemauerten Ofens angebracht; er muß so dick seyn, daß er keinen
Wärmeverlust während der Operation bemerken läßt.
M ist eine kleine viereckige Schale von versilbertem
Kupfer, welche 51 Grm. Copalstücke enthält; sie befindet sich in einer Höhlung des
Eisenblockes von 10 Centim. Breite, 5 Centim. Höhe und 20 Centim. Tiefe, welche
durch die Platte N verschlossen werden kann.
Aus dem Hintergrunde der Höhlung vermittelt eine Röhre die Verbindung mit dem Kühlapparate O von gewöhnlicher Construction, an dessen Ausgang die
Röhre in die geschlossene Vorlage P mündet.
Zunächst wird der Gußeisenblock allein auf höchstens 400°C. erhitzt, was man
am beginnenden Schmelzen eines eingelegten Zinkstückes erkennt. Alsdann schiebt man
die Schale mit dem Copal ein, schließt die Oeffnung und unterhält ein gelindes
Feuer, damit der Block über 10 Minuten lang seine Hitze behält. Es sammeln sich
alsdann die condensirten Dämpfe des Copals als gelbes klares Oel in der Vorlage P. Die Destillation ist beendigt, wenn etwa 10–12
Kubikcentim. Oel, also ein Viertel des Copalgewichtes condensirt sind. Man nimmt nun
die Schale heraus und gießt den Copal in dünne Scheiben, wo er sich dann leicht bei
gewöhnlicher Temperatur in dem Oelgemisch auflöst.
Ein anderer Apparat ist in Fig. 18 dargestellt. Q ist eine kupferne, innen versilberte Blase von 50
Centim. Durchmesser, in welche 5 Kilogr. Copal durch die obere, nachher sorgfältig
zu verschließende Oeffnung eingeschüttet werden; die Blase ruht auf Zapfen und kann
mittelst einer Kurbel bewegt werden. R ist der Ofen zum
Erhitzen der Blase, er ist mit dem beweglichen Dome S
und einem Kamin versetzen. T ist der Kühlapparat. U ist das Ableitungsrohr für die entwickelten Dämpfe,
welches einerseits durch eine Stopfbüchse mit dem einen hohlen Zapfen der Blase,
andererseits mit der Vorlage für das condensirte Oel verbunden ist.
Nach Beschickung der Blase gibt man ein gelindes Feuer und dreht die Blase langsam
um, wobei der Copal sich zusammenballt und regelmäßig an die Wandung festsetzt.
Alsbald beginnt die Dampfentwickelung; die Menge des sich condensirenden Oeles zeigt
hinreichend genau die Stärke des Feuers an, welches darnach regulirt werden kann;
die Blase dreht man ununterbrochen. Die Operation ist beendet, wenn das verlangte
Oelquantum, dem beabsichtigten Copalverlust entsprechend, erhalten ist Man nimmt nun
S ab, löst das Rohr U
und hebt die Blase mittels eines kleinen Krahns heraus, um sie durch eine andere zu
ersetzen. Den geschmolzenen Copal gießt man in ein flaches weites Gefäß in dünne
Tafeln aus.
Wie der Verf. bemerkt, hat dieser Apparat gegen den vorigen den Vortheil, daß die dem
Feuer ausgesetzten Copaltheile unaufhörlich erneuert werden, so daß das Harz weniger
verändert wird; da aber die Stärke des Oelabflusses die einzige Richtschnur für die
Leitung des Feuers bildet, so kann man die Temperatur nicht genau innehalten.
Ein dritter Apparat ist in Fig. 19 dargestellt. Er
unterscheidet sich von
dem vorhergehenden nur dadurch, daß die Blase feststeht und der Copal bewegt
wird:
a ist eine cylindrische Blase von innen versilbertem
Kupfer; ihr Durchmesser beträgt 1 Meter, ihre Höhe 70 CentimeterDer Verf. empfiehlt, bei allen Apparaten kein Eisen in Berührung mit dem
Copal anzuwenden, da sich dieser sonst augenblicklich schwarz färbt.; sie hat einen flachgewölbten Deckel und ist ganz in den Ofen eingemauert.
Die Oeffnung b ist dicht verschließbar und dient zum
Einbringen von 100 Kilogr. Copal.
c ist der von außen zu bewegende Rührer mit verticaler
Achse; d eine mit einem Korkpfropf verschlossene Röhre
zum Ausleeren des präparirten Copals; e ist das
Abzugsrohr für die Destillationsdämpfe.
Auch hier bietet der Oelabfluß die einzige Richtschnur für die Leitung des Feuers;
indessen ließe sich wohl ein Indicatorstopfen von einer schmelzbaren Legirung
anbringen.
Der Rührer muß stets in Bewegung seyn; anfangs geht dieß, wegen der teigigen
Beschaffenheit der Masse, schwer, dann aber um so leichter, je flüssiger der Copal
wird, wornach man auch die Operation einigermaßen leiten kann. Nach etwa zwei
Stunden entspricht das sich ansammelnde Oel dem vierten Theil des Copalgewichtes,
worauf man den Copal durch d ausfließen läßt und in
Tafeln formt.
Eigentliche Darstellung des fetten Firnisses. –
Nachdem der Copal in einem der beschriebenen Apparate die vorbereitende Destillation
erlitten hat, ist die Darstellung des Firnisses sehr leicht; man braucht den Copal
nur in einem Wasser- oder Dampfbad in der erforderlichen Menge des
Oelgemisches aufzulösen. Hierzu kann man sich mit Vortheil der in Fig. 20 dargestellten
Einrichtung bedienen. f ist ein cylindrisches Gefäß von
verzinntem Kupfer oder verzinktem Eisen; die Höhe desselben beträgt, ebenso wie der
Durchmesser, 1 Meter. Es ist mit einem Deckel zur Verhütung des Verdunstens und mit
einem hölzernen Mantel zur Wärmehaltung versetzen, und dient zur Aufnahme des
Oelgemisches und des geschmolzenen Copals. Dieser liegt auf dem Sieb g von verzinnten Eisendrähten, welches 20 Centimeter
tief in die Flüssigkeit taucht. Die Erwärmung der letzteren geschieht mittelst der
kupfernen Schlange h, welche am Boden des Gefäßes liegt
und mit einem Dampfkessel verbunden ist. Der Hahn j
dient zum Entleeren des Firnisses.
Man bringt in das Gefäß zunächst ein Gemisch von 100 Kil. Leinöl und 300 Kilogr.
Terpenthinöl, und darauf 100 Kilogr. präparirten Copal.
Man erwärmt durch den Dampf, und befördert dadurch die Auflösung, welche ohne alle
Handarbeit und ohne Verlust vor sich geht, so daß beiläufig 5 Hektoliter Firniß
erhalten werden.
Copalöl. – Das Copalöl, welches etwa ein Viertel
des rohen Copals bildet, hat eine Dichtigkeit von 0,80; es brennt an der Luft mit
sehr heller Flamme, ist in Leinöl und Terpenthinöl löslich, und löst selbst den
weichen und halbharten Copal auf. Man könnte dieses Oel daher mit Vortheil bei der
Firnißdarstellung benutzen, wenn man ihm seinen starken und durchdringenden Geruch
benehmen könnte; man würde so den Destillationsverlust des Copals vollkommen wieder
ersetzen.
Der Verf. wünscht, daß strebsame und umsichtige Fabrikanten sich bemühen möchten den
löslichen Copal darzustellen, und so die Industrie
mit einem neuen Producte zu bereichern, welches in einem wichtigen und bisher ganz
der Empirie überlassenen Gewerbszweige eine vollkommene Umwälzung hervorbringen
würde.
Tafeln