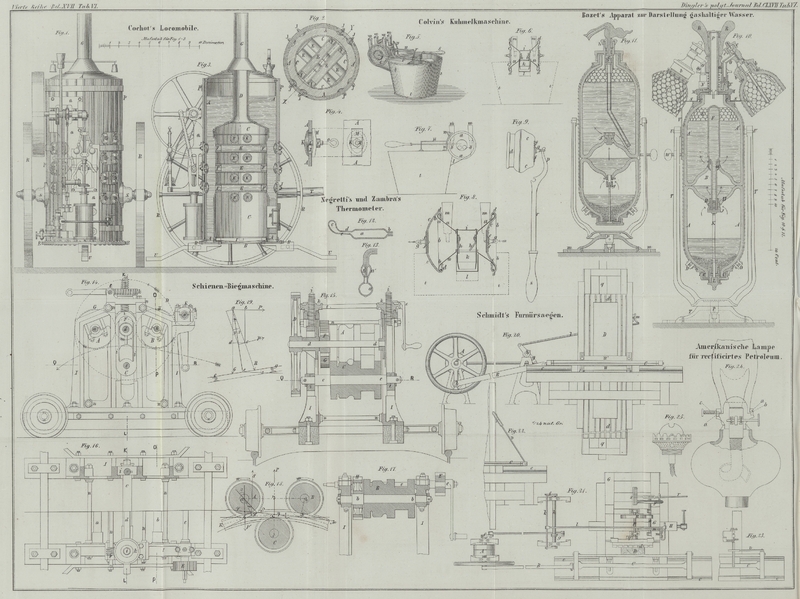| Titel: | Cochot's neues System von Locomobilen; Bericht von Combes. |
| Fundstelle: | Band 167, Jahrgang 1863, Nr. C., S. 401 |
| Download: | XML |
C.
Cochot's neues System
von Locomobilen; Bericht von Combes.
Aus dem Bulletin de la
Société d'Encouragement, October 1862, S. 577.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Cochot's neues System von Locomobilen.
Der Maschinenfabrikant August Cochot in Paris (rue Moreau, 12 und 14) ließ sich ein neues System von
Locomobilen patentiren, welches die Mitglieder des Ausschusses für mechanische
Gewerbe in den Werkstätten des Constructeurs untersucht haben.
Cochot's Locomobile unterscheidet sich durch die Bauart
des Kessels und die Unterbringung der Maschinentheile wesentlich von den bisher
bekannten Systemen. Der Kessel, dessen Achse nicht horizontal liegt, sondern
vertical steht, wird durch einen äußeren, aus Eisenblech zusammengenieteten Cylinder
(Mantel) gebildet, welcher unten auf einem ebenen Ringe von etwas größerem
Durchmesser ruht, mit dem er durch ein kreisförmig gebogenes Winkeleisen verbunden
ist. Dieser Cylinder wird oben durch einen flachen Dampfdom geschlossen, in dessen
Mitte eine Oeffnung angebracht und ein Blechrohr eingepaßt ist, das mittelst eines
kreisförmigen Winkeleisens an denselben befestigt ist. Darüber erhebt sich der
Schornstein, dessen Achse genau in der Verlängerung des eben erwähnten Rohres liegt.
In dem Inneren des äußeren Cylinders befindet sich ein zweiter, mit dem ersteren
concentrischer Cylinder, welcher unten auf demselben ebenen Ringe aufsteht und oben
auch durch einen Dampfdom geschlossen wird, der in seiner Mitte ebenfalls eine
Oeffnung hat, über welche dasselbe Rohr genau anschließend befestigt wird, das oben
auf die beschriebene Weise mit dem Dampfdome des äußeren Cylinders verbunden ist.
Das Wasser füllt den zwischen den beiden Cylindern enthaltenen Raum bis zu einer
gewissen Höhe über dem inneren Dampfdom aus und umgibt also einen Theil des Rohres,
welches in den Schornstein endigt. Der untere Theil des inneren Cylinders, welcher
einen etwas größeren Durchmesser hat als der obere, bildet den Feuerraum; die
Roststäbe liegen mit
ihren Enden auf dem nach innen vorspringenden Rande des ebenen Ringes, an welchen,
wie gesagt, sowohl der äußere, als auch der innere Cylinder befestigt ist. Die
Verbrennungsproducte, der Rauch und die Gase entweichen durch das auf den inneren
Cylinder aufgesetzte Rohr in den Schornstein. Dieselben umspielen auf ihrem Wege
vierzehn Blechröhren, welche mit Wasser angefüllt und paarweise in sieben Lagen über
einander auf folgende Art angeordnet sind: Das untere, dem Feuerraum zunächst
liegende Paar besteht aus zwei unter sich parallelen, nur wenig gegen die
Horizontalebene geneigten Röhren, welche in geringem, aber gleichweitem Abstand von
einer durch die Achse des Kessels gelegten Verticalebene angebracht sind. Die Enden
der Röhren sind mittelst Stahlringen in abgeplattete, sich gegenüberliegende Stellen
der Wandung des inneren Cylinders ebenso befestigt, wie die Heizröhren der
Locomotiven und der gewöhnlichen Locomobilen in die Wände der Feuerbüchse und
Rauchkammer. Unmittelbar über dem unteren Paare liegt ein zweites Paar unter sich
paralleler Röhren, welche auf dieselbe Weise angebracht, aber um einen Viertelkreis
um die Achse des Kessels umgedreht werden, so daß sich die Röhrenachsen des unteren
und zweiten Paares in der Horizontalprojection rechtwirklich schneiden. Die Achsen
des dritten Röhrenpaares liegen wieder rechtwirklich zu denen des zweiten und
parallel mit jenen des ersten; auf diese Weise werden dieselben weiter bis zu dem
siebenten Paare angeordnet, welches nur in geringem Abstande von dem Dampfdome des
inneren Cylinders liegt. Damit diese Röhren, – welche eben so viele kleine
Sieder bilden, in denen die Dampferzeugung gut von Statten geht und das Wasser in
Folge der kleinen Neigung, unter der sie angebracht sind, in ununterbrochener
Circulation erhalten wird, – nachgesehen und von dem Kesselsteine gereinigt
werden können, den hartes, kalkreiches Brunnenwasser ansetzt, hat Cochot in dem äußeren Cylinder, einem jeden von den
beiden Enden der Röhren gegenüber, ovale Oeffnungen (Reinigungsluken) angebracht,
welche, wenn der Kessel in Thätigkeit ist, von innen durch gußeiserne Platten
dampfdicht geschlossen werden. Jede von den letzteren wird mittelst eines
eingelassenen Schraubenbolzens an ihren Platz gebracht, dessen Kopf durch die
Oeffnung eines außen befindlichen, passend gebogenen Bügels gesteckt und mittelst
einer Mutter festgehalten wird, welche den Bügel von außen und die Platte von innen
gegen die Cylinderwandung preßt. Auf diese Weise sind an den vier Seiten des äußeren
Cylinders 28 solcher Oeffnungen mit sogenanntem Selbstverschluß angebracht, welche
sich, wie schon erwähnt wurde, der Lage der Sieder entsprechend gegenüber
liegen.
Alle unbeweglichen Theile der Maschine, wie der Dampfcylinder, die Speisepumpe, die Lager für die
Welle des Schwungrades und der Kurbel, sowie der Watt'sche Centrifugalregulator sind dauerhaft mit einer starken gußeisernen
Platte verbunden, welche durch Bolzen an den Kessel befestigt ist. Der Dampfcylinder
steht vertical neben dem unteren Theile des Kessels, und die Welle für die Kurbel
und das Schwungrad ist oberhalb des Cylinders angebracht. Alle Theile haben eine
passende Lage erhalten und nehmen sehr wenig Raum ein.
Die ganze Maschine wird zum Zwecke ihres Transportes von zwei großen Rädern getragen,
durch deren Naben die Achsschenkel gesteckt werden, welche in gußeiserne, an zwei
sich gegenüber liegenden Seiten der Kesselwandung durch Bolzen befestigte Büchsen
passen. Zwei hölzerne, in dieselben gußeisernen Büchsen eingezapfte Deichseln bilden
zwischen den beiden Rädern eine Art Gabel, in welche man ein Pferd spannen kann.
Wenn die Maschine nicht auf Rädern ruht, so erhält sie vier gußeiserne Füße und wird
auf das Terrain gestellt, nachdem man zuvor Holzstücke untergelegt hat.
Die Maschine, welche der Ausschuß in den Werkstätten des Constructeurs besichtigt
hat, besitzt eine Mächtigkeit von drei Pferdekräften, sowie ein Totalgewicht von 850
Kilogrammen und wird auf ziemlich ebenem Terrain von zwei Arbeitern mit Leichtigkeit
fortgezogen. Eine solche verticale Locomobile mit gekreuzten und etwas geneigt
liegenden Siedern verbraucht bei ununterbrochenem Gange der Arbeitsmaschine per Stunde und Pferdekraft 3 1/2 Kilogrm. Kohle (?).
Die Construction dieser neuen Locomobile scheint sehr gut zu seyn; der geringe Raum,
welchen sie im Grundrisse einnimmt, die Leichtigkeit, mit welcher die Siederöhren im
Innern und von Außen gereinigt werden können, die verticale Stellung des
Dampfcylinders, die dauerhafte Befestigung aller unbeweglichen Theile der auf so
einfache Weise zusammengestellten Maschine, der in Folge ihrer günstigen Form und
ihres nicht unbedeutenden Gewichtes leichte Transport derselben, sind Vortheile,
welche diesem Systeme eigen sind, oder die es wenigstens in einem viel höheren Grade
besitzt, als die übrigen.
Die besichtigte Maschine ist, wie alle anderen, welche aus Cochot's Wertstätte hervorgehen, dauerhaft und sorgfältig construirt.
Beschreibung der Cochot'schen
Locomobile.
Fig. 1 vordere
Ansicht der Maschine.
Fig. 2
Horizontaldurchschnitt durch den Kessel (nach Fig. 1) und durch ein Paar
Siederöhren.
Fig. 3
verticaler Durchschnitt nach der Linie XY in Fig. 2 durch
die Achse des
Kessels. Bei dieser Figur hat man zum leichteren Verständniß der Zeichnung die Lage
der Röhrenpaare zu der verticalen Durchschnittsebene der Maschinenräder nicht schief
angenommen, wie sie in Wirklichkeit ist.
Fig. 4 vordere
Ansicht und Querdurchschnitt eines der den Siederöhren gegenüber angebrachten
inneren Verschlüsse (Selbstverschlüsse) der Reinigungsluken des Kessels. (Diese
Figur ist in einem größeren Maaßstabe gezeichnet.)
Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren dieselben Maschinentheile. A äußerer Cylinder des Kessels, welcher oben durch einen
flachen Dampfdom geschlossen wird, in dessen Mitte eine Oeffnung angebracht ist,
über welcher der Schornstein befestigt wird.
B ein ebener Ring, welcher dem Kessel als Grundfläche
dient; durch ein kreisförmiges von außen angelegtes Winkeleisen mit einer doppelten
Reihe von Nieten wird eine dauerhafte Verbindung des äußeren Cylinders mit diesem
Ringe hergestellt.
C innerer Cylinder des Kessels, welcher ebenfalls auf
dem Ringe B ruht, mit dem er auf dieselbe Art durch ein
von innen angelegtes Winkeleisen verbunden ist; ein flacher, in seiner Mitte mit
einer Oeffnung versehener Dampfdom schließt oben diesen Cylinder.
D ein Rohr, welches mit seinem erweiterten unteren Rande
auf die Oeffnung im Dampfdome des Cylinders C paßt,
während es mit seinem oberen Ende genau in die bereits erwähnte Oeffnung im
Dampfdome des äußeren Cylinders A eingesteckt und
mittelst eines kreisförmigen Winkeleisens an letzterem befestigt wird.
E Siederöhren aus Eisenblech, welche mit Wasser
angefüllt sind und etwas geneigt gegen die Horizontalebene liegen; es sind vierzehn
Stück derselben vorhanden, welche paarweise, in sieben Lagen abwechselnd, im rechten
Winkel übereinander angebracht sind.
F Stahlringe zur Befestigung der offenen Röhrenenden E in die zu diesem Zwecke in der Cylinderwandung C angebrachten Oeffnungen.
G Schornstein, welcher mit seinem conisch gestalteten
Untertheile auf den Dampfdom des äußeren Cylinders A
befestigt ist und in welchen das Rohr D endigt. H Feuerthüre.
I die unten im Inneren des Cylinders C angebrachten Roststäbe, welche auf dem vorspringenden
Rande des Ringes B aufliegen.
J acht und zwanzig ovale Oeffnungen, welche (der Neigung
der Siederöhren entsprechend) an flachen, sich entgegengesetzten Stellen des äußeren
Cylinders A, gerade jedem Ende der Siederöhren E gegenüber, angebracht sind. Dieselben gestatten das Nachsehen und
Reinigen der letzteren und werden, wenn der Kessel in Thätigkeit ist, durch
gußeiserne Platten K geschlossen gehalten, welche sich
von innen fest an etwas abgeplattete Stellen der Cylinderwandung anlegen; eine
derselben ist in Fig. 4 im Detail abgebildet.
L ein mit seinem einen Ende in die Platte K eingelassener Bolzen, welcher durch den Bügel M hindurchgeht.
M ein passend gebogener Bügel, welcher sich von außen
über die Reinigungsluke hinweg an die Kesselwandung anlegt.
N Schraubenmutter, welche auf den Kopf des Bolzens L aufgeschraubt wird, wodurch zugleich die Platte K und der Bügel M fest gegen
die Kesselwandung angedrückt werden.
Wenn man eine Reinigungsluke J öffnen will, so beginnt
man damit, in das Ende des Bolzens L, welcher zu diesem
Zwecke ein Loch mit innerem Gewinde erhält, einen kleinen Haken O einzuschrauben, der in Fig. 4 punktirt ist und
nach dem Losschrauben der Mutter N die Platte K an dem Herabfallen in den Kessel hindert. Hierauf wird
die Mutter abgenommen, indem man sie um den Haken O
herumschiebt, wodurch der Bügel M frei wird und die
Platte K, nach einer Umdrehung von 90º und durch
schräges Einstecken in die Reinigungsluke J, leicht
herausgenommen werden kann.
P hölzerner Mantel um den Kessel, welcher unmittelbar
vor den Reinigungsluken J mit entsprechend großen
Oeffnungen versehen ist, in welche je zwei Bügel M zu
liegen kommen.
Q gußeiserne Platte, welche mit Bolzen an den Kessel
befestigt ist und den Dampfcylinder, die Speisepumpe, die Lager für die Welle des
Schwungrades und der Kurbel, sowie den Centrifugalregulator und alle sonstigen
Maschinentheile trägt, welche aus den Figuren 1 und 2 so deutlich
zu ersehen sind, daß eine Bezeichnung derselben mit Buchstaben überflüssig
erscheint.
R Räder zum Transport der Maschine.
S gußeiserne Büchsen, welche mit Bolzen an dem Kessel
befestigt sind und die Achsschenkel aufnehmen, auf welche die Radnaben genau
passen.
T eine Gabel zum Fortziehen der Maschine; die Deichseln
derselben sind in die gußeisernen Büchsen 8 eingezapft.
U zwei gußeiserne Füße, unter welche man Holzstücke
legt, sobald die Maschine an dem Orte angekommen ist, wo sie arbeiten soll.
Tafeln