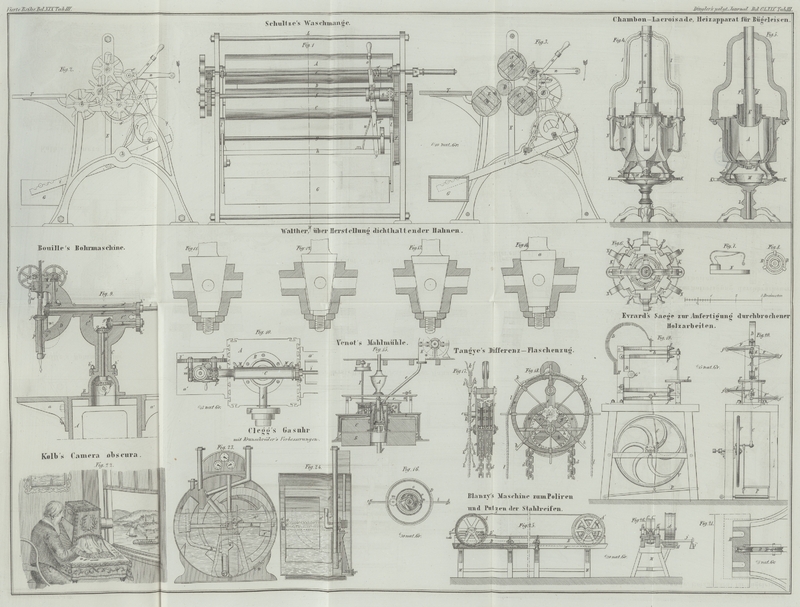| Titel: | Clegg's Gasuhr mit den Verbesserungen von Krunschröder. |
| Fundstelle: | Band 169, Jahrgang 1863, Nr. XLV., S. 179 |
| Download: | XML |
XLV.
Clegg's Gasuhr mit den
Verbesserungen von Krunschröder.
Aus dem Mechanics'
Magazine, October 1862, S. 277.
Mit Abbildungen auf Tab.
III.
Clegg's neue Gasuhr mit Krunschröder's Verbesserungen.
Diese Gasuhr war von den HHrn. Bischoff, Brown und Comp. in London (Langham Works, George-street, Great Portland-street), welche die verschiedenen Patente Clegg's erworben haben, auf die
vorjährige Londoner Industrie-Ausstellung geliefert worden. Bekanntlich hat
Samuel Clegg fast ein halbes Jahrhundert sich mit großem
Erfolg mit Gasapparaten beschäftigt, und schon im Jahr 1815 das erste Patent auf
seine Gasuhr erhalten. Noch im Jahr 1858, zwei Jahre vor seinem Tode, hat er diese
verbessert und vervollkommnet. Er war überzeugt, daß die Angaben derselben von
etwaigen Veränderungen im Wasserstande (sey es in Folge von Verdunstung oder von
Wasserzusatz) unabhängig gemacht werden müssen. Ehe er jedoch seine Ideen zur
schließlichen Ausführung bringen konnte, starb er, und erst einer seiner
Angestellten, Hr. Krunschröder, hat dieselben
verwirklicht. Fig.
23 ist eine Vorderansicht des verbesserten Meßapparates, worin einige
Theile im Durchschnitt gezeichnet sind, und Fig. 24 ist ein
Querdurchschnitt desselben.
Derselbe besteht im Wesentlichen aus einer Trommel (oder einer Reihe excentrischer
Kammern), die um ein mittleres Luftgefäß angebracht ist, welches das Steigen und
Sinken je nach der Höhe des Wasserstandes gestattet. Die Folgen der Reibung auf den
Lagern sind somit vermieden und der Meßapparat kann solid construirt werden; ist
derselbe einmal regulirt, so behält er seine Genauigkeit bei jedweder Aenderung im
Wasserstand oder im Druck.
Der hohle Mitteltheil der Trommel ist hinten geschlossen, vorne hat er einen in der
Mitte durchbohrten Deckel. Diese Oeffnung liegt aber unterhalb des Wasserspiegels,
so daß der Mitteltheil der Trommel gasdicht verschlossen ist. In dem Mitteltheil
befindet sich ein hohler Schwimmer, zwischen welchem und dem Vordertheil der Trommel
ein Raum bleibt, in den das Gas durch eine Abzweigung des Gasrohres geleitet wird,
welche in die Oeffnung in der Mitte des Vordertheils der Trommel gesteckt wird. Die
Achse a der Trommel ist in der Mitte des Hintertheils
der Trommel a¹ und andererseits in der Mitte des
Vordertheils a² des Schwimmers befestigt. Auf
diese Weise dreht sich die Meßtrommel um ihre Achse a.
Die Vorderseite der Trommel a³ ist, wie oben
erwähnt, überall geschlossen mit Ausnahme der Mittelöffnung a⁴, welche sich stets unter dem Wasserstande in und außerhalb der
Trommel befindet. Das hintere Ende der Achse a der
Meßtrommel liegt in einem Lager oder Loch in dem Rahmen b, welcher in festen Achsen oder Hälsen c, c
sich bewegt, von denen einer am hintern Ende der Uhr, der andere nahe an dem
Vordertheil oberhalb des gleich zu beschreibenden Ablaufgefäßes angebracht ist.
Der Rahmen b wirkt so als Hebelrahmen, indem die Achse
a der Trommel von demselben an der einen Seite
seiner Achsen getragen wird, während an der anderen Seite dieser Achsen der Rahmen
an ein umgekehrtes, als Regulator wirkendes Gefäß d
befestigt ist. dieses Regulatorgefäß ist unten offen, aber an den Seiten und oben
geschlossen.
Das Vorderende der Achse a der Trommel geht durch einen
Schlitz in dem Hebelrahmen b, daher dieses Ende, während
der Rahmen b sich auf seinen Achsen bewegt, sich
zeitweise in einer größeren und zeitweise in einer kleineren Entfernung von der
Bewegungsachse des Rahmens zu befinden vermag; aber die Achse a der Trommel wird jederzeit in ihrer richtigen Stellung erhalten mittelst
eines verticalen Schlitzes in der Platte oder dem Rahmen e oberhalb des Ueberlaufgefäßes, welches an der Vorderseite der Uhr
angebracht ist; f ist ein Gewicht, welches am Rahmen b verschoben und beliebig befestigt werden kann, um den
richtigen Gang des Regulirgefäßes und der Meßtrommel zu adjustiren.
Das in Fig. 23
dargestellte Wasserniveau ist das der horizontalen Stellung des Rahmens b entsprechende. Es kann bald höher, bald niedriger,
niemals aber so niedrig seyn, daß es bis unter den oberen Rand der Oeffnung a⁴ an der Vorderseite der Meßtrommel sinkt, sonst
würde das Gas durch jene
Oeffnung in das Gehäuse gelangen. g ist das
Ueberlaufgefäß an der Vorderseite der Uhr; dasselbe ist durch eine Scheidewand g¹ (Fig. 24) getheilt, so daß
immer in einem Theil des Gefäßes das Wasser bis oben an die Wand g¹ stehen muß, daher das untere offene Ende des
Gaszuleitungsrohres h stets vom Wasser geschlossen
bleibt und folglich kein Gas daraus in das Gefäß g
gelangen kann. Etwa die Scheidewand g¹
überfließendes Wasser kann durch das Abzugsrohr g² abziehen. Das Gasrohr h tritt von oben
in die Uhr, ist an der Vorderseite derselben gebogen und reicht fast bis zum Boden
des Ueberlaufgefäßes g hinunter. Es hat zwei Arme h¹ und h²; der erstere h¹ geht
seitwärts, bis er unter die Vorderseite des umgekehrten oder
Regulator-Gefäßes gelangt, dann steigt das Rohr schräg in die Höhe, bis es
über den höchsten Wasserstand im hinteren Theil des umgekehrten Gefäßes kommt, läßt
aber dabei einen Zwischenraum zwischen dem oberen Ende von h¹ und der inneren Oberfläche dieses Gefäßes, so daß letzteres im
Wasser frei steigen und sinken kann, ohne das Röhrenende da zu berühren, wo dieses
im Gefäße über das Wasser hervorragt.
Es ist hiernach klar, daß das Regulirgefäß stets mit Gas über dem Wasserstand des
Gasmessers gefüllt ist und daß sein Steigen die Achse a
der Meßtrommel hinabzudrücken strebt; die Wirkung dieses Bestrebens wird durch die
Stellung des oben erwähnten Gewichtes an dem Rahmen b
regulirt. Dadurch, daß das Zweigrohr h¹ von vorne
nach hinten im Regulirgefäß geneigt ist, wird verhindert, daß Gas aus der Uhr durch
Rückwärtsneigen derselben genommen werden kann, da hierdurch das Wasser darin in dem
Rohre h¹ hinabfließen müßte.
Das Wasser wird in den Apparat durch das Rohr i
eingeführt, welches ebenso wie das Gasrohr und das Ableitungsrohr an dessen
Vorderseite befindlich ist. An dem oberen Theile des Regulators d ist eine biegsame Klappe angebracht, welche bei ihrer
Berührung mit dem inneren Ende der Abführungsröhre den Austritt des Gases aus der
Uhr verschließt.
Das Gas geht aus dem Einströmungsrohr zur Meßtrommel durch das Zweigrohr h², welches an der
Vorderseite der Trommel durch die Oeffnung a⁴
eintritt und bis zum höchsten passenden Wasserstand der Gasuhr hinaufreicht, nämlich
etwas weniger hoch über das Wasser als das Rohr h¹, welches noch ein wenig über den
höchsten Wasserstand hinaufreicht. Das Wasser in der Uhr kann nicht über die Mündung
des Rohres h² steigen, da es sonst durch dasselbe
in das Ueberlaufgefäß hinab fließen würde.
k ist eine endlose Schraube an dem Vorderende der
Trommelachse, welche in
das Getriebe l an der Achse m eingreift, mittelst deren die Umdrehungen der Trommel in gewöhnlicher
Weise gezählt werden. Das Wasser der Uhr kann man durch die Oeffnung n entleeren.
Tafeln