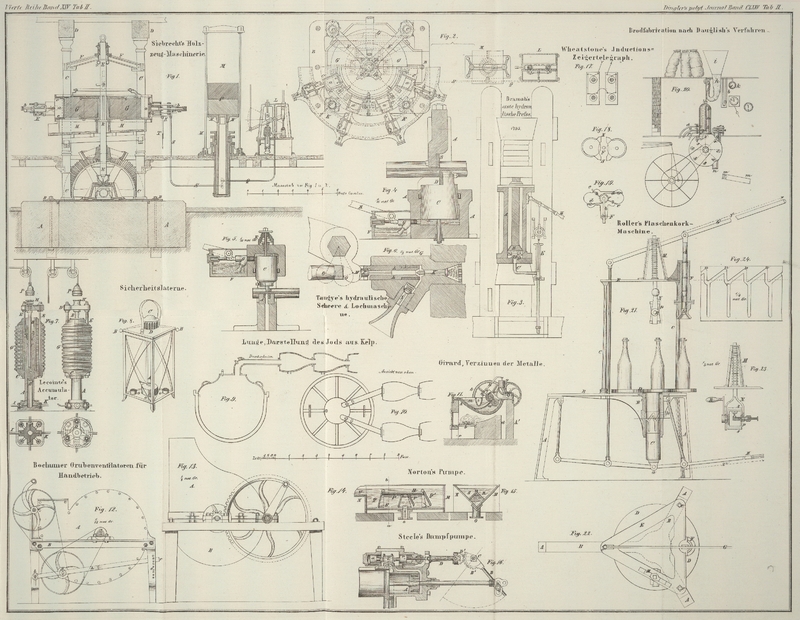| Titel: | Wheatstone's Inductions-Zeigertelegraph. |
| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XXXI., S. 117 |
| Download: | XML |
XXXI.
Wheatstone's
Inductions-Zeigertelegraph.
Nach der Zeitschrift des deutsch-österreichischen
Telegraphenvereins, Jahrg. XI S. 64; aus dem polytechnischen Centralblatt, 1864 S. 1562.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Wheatstone's Inductions-Zeigertelegraph.
Wheatstone hat dem von ihm construirten, mit
magneto-elektrischen Inductionsströmen arbeitenden Zeigertelegraph, welcher bei dem
Londoner Stadttelegraph (Universal Private
Telegraph-Company) im Gebrauche steht, eine äußerst sinnreiche und
compendiöse Einrichtung gegeben.
Die Inductionsströme werden durch Rotation eines Ankers
A aus weichem Eisen von den auf die Pole eines
kräftigen hufeisenförmigen Stahlmagnetes M aufgesetzten
Kernen der Inductorrollen bewegt. Dieser aus sieben Lamellen bestehende Stahlmagnet
ist mit Polschuhen aus weichem Eisen armirt, deren jeder zwei cylindrische
Eisenkerne trägt. Auf diese Kerne, welche die Endpunkte eines Quadrates bilden, sind
die vier Inductorrollen aufgeschoben und so wie Fig. 17 zeigt, mit
einander verbunden; die aus den Rollen hervortretenden Enden der Kerne sind durch
Schrauben in einer aufgeschobenen starken Messingplatte befestigt, vor welcher der
Eisenanker A rotirt, dessen Achse durch eine in der
Mitte der Platte befindliche Durchbohrung frei hindurch geht und zwischen
Kernspitzen spielt, welche von zwei an der Platte angebrachten Bügeln getragen
werden. Auf der Achse des Ankers ist am vorderen Ende ein Rad mit 45 schräg
geschnittenen Zähnen aufgekeilt, in welches ein größeres mit 180 ebenso
geschnittenen Zähnen eingreift, dessen Achse der Ankerachse parallel liegt und durch
eine Kurbel mit der Hand in Umdrehung versetzt werden kann. So oft nun der Anker A bei seiner Rotation sich zwei diagonal gegenüber
stehenden Kernenden nähert, entsteht in den aufgeschobenen Drahtrollen ein
Inductionsstrom, und wenn der Anker bei fortgesetzter Rotation sich von eben diesen
Kernen wieder entfernt, entsteht ein Inductionsstrom von entgegengesetzter Richtung.
Beim Fortgange des Ankers über ein solches diagonales Kernpaar tritt also jedes Mal
ein Wechsel in der Richtung der Inductionsstöße ein; dieß wiederholt sich bei jeder
Umdrehung des Ankers vier Mal, es entstehen also bei jeder Umdrehung vier Wechsel in
der Stromrichtung, denn von den dabei auftretenden acht Inductionsstößen sind je
zwei auf einander folgende, nämlich je ein Abreißungs- und der darauf folgende
Annäherungsstrom, von gleicher Richtung. Der Empfangsapparat ist so eingerichtet,
daß der Zeiger desselben bei jedem Wechsel in der Stromrichtung um eins der 30
Felder des Alphabetkreises fortrückt; derselbe wird also bei jeder ganzen Umdrehung
des Ankers um 4, bei jeder ganzen Umdrehung der Kurbel aber um 16 Felder fortrücken,
so lange beim Zeichengeber nicht die Verbindung zwischen dem Inductor und der
Leitung unterbrochen wird.
Der eigentliche Zeichengeber besteht, wie gewöhnlich bei
derartigen Telegraphen, aus einer Buchstabenscheibe von gleicher Einrichtung und
Eintheilung wie beim Empfangsapparate; über der Buchstabenscheibe rotirt beim
Telegraphiren ein Zeiger, der mit dem des Empfangsapparates stets gleichen Schritt
hält; eine Claviatur von 30 im Kreise um die Buchstabenscheibe stehenden Tasten
dient dazu, den Zeiger festzustellen und gleichzeitig den Stromweg zu unterbrechen,
sobald ersterer bei seinem Umgange das Buchstabenfeld erreicht hat, dessen Taste
niedergedrückt worden.
Die Bewegung des Zeigers des Zeichengebers wird nicht durch die Telegraphirströme,
sondern auf mechanischem Wege durch Räderübertragung bewirkt. Auf der Achse der
bereits erwähnten Kurbel sitzt nämlich noch ein conisches Rad mit 48 Zähnen und
greift in ein horizontal liegendes conisches Rad mit 90 Zähnen ein; auf dem
letzteren ist eine am Umfange mit vorstehenden Nasen versehene Scheibe N befestigt und in einer cylindrischen Vertiefung dieses
Rades und in dieser Nasenscheibe hat die verticale Achse des Zeigers lose Führung,
ist aber mit diesen Theilen nur durch einen auslösbaren Mitnehmer verbunden, nimmt
also an der Bewegung des Rades und der Nasenscheibe nur dann Theil, wenn der
Mitnehmer in Eingriff ist. Ist dieß der Fall, so wird der Zeiger bei jeder ganzen
Umdrehung der Kurbel über (48 . 30)/90 = 16 Felder der Buchstabenscheibe
fortschreiten, also über eben so viel Felder, als Richtungswechsel der
Inductionsströme stattfinden. Dieser Theil des Apparates ist durch einen aus dünnem
Messingblech gedrückten, nur die Tasten und die mit einer Spiegelglasplatte
überdeckte Buchstabenscheibe frei lassenden Mantel gegen Staub und Beschädigung
geschützt, während die darunter liegenden Theile nebst Inductor von einem eleganten
Holzkästchen umschlossen sind, welches mittelst eines Aufsatzes den in einer drehbar
befestigten Holzbüchse enthaltenen Zeichenempfänger trägt. Von den 30 Feldern der
Buchstabenscheibe sind 26 mit Buchstaben in alphabetischer Folge, 3 mit den
üblichsten Interpunctionszeichen (, ; .) und das 30. mit einem + bezeichnet; ein
innerer Kreis enthält die zehn Ziffern zwei Mal.
Die Tasten sind Winkelhebel, welche an ihrem horizontalen
Arme einen Kropf tragen, mit dem verticalen aber in radiale Einschnitte einer
horizontalen Scheibe S hinein ragen; sie werden durch
eine Winkelfeder, welche mit dem einen Ende in ein Loch des verticalen Arms, mit dem
anderen in eine Vertiefung der Scheibe S eingesteckt
ist, in ihrer Stellung erhalten, indem die Feder den verticalen Arm nach außen
drückt; wird aber eine Taste niedergedrückt, so kommt die Feder in eine solche Lage,
daß sie den verticalen Arm jetzt nach innen drückt, also wiederum die Taste in ihrer
jetzigen niedergedrückten Lage erhält. Sobald aber eine andere Taste niedergedrückt
wird, springt die vorher niedergedrückt gewesene von selbst in die Höhe; unter der
Scheibe S liegt nämlich in einer kreisförmigen Nuth eine
um 30 zwischen den Tasten liegende Rollen gelegte Kette ohne Ende und wird, wenn
eine Taste niedergedrückt wird, straff angespannt, indem dabei das untere Ende des
verticalen Armes die Kette erfaßt und zwischen den beiden benachbarten Rollen in
einem Bogen nach innen
abbiegt; drückt man nun eine andere Taste, so kann deren verticaler Arm die Kette
nur zu einem Bogen abbiegen, indem zugleich der frühere Bogen wieder beseitigt, die
frühere gedrückte Taste also wieder in ihre Ruhelage zurückgebracht wird.
Der Mitnehmer besteht zunächst aus einem auf der
Zeigerachse unwandelbar befestigten radialen Arme Q, der
über der Scheibe S liegt und beinahe bis zu den radialen
Schlitzen derselben reicht; an seinem Ende sitzt ein leicht drehbarer Winkelhebel,
dessen radialer Arm q über Q
so weit vortritt, daß er die Tastenhebel in der Ruhelage nicht erreicht, wohl aber
an dieselben anstößt, sobald sie niedergedrückt sind; der andere tangential an der
erwähnten Nasenscheibe N liegende Arm des Winkelhebels
kann mit einem Haken hinter die Nasen der Nasenscheibe eingreifen und thut dieß für
gewöhnlich durch die Wirkung einer Messingfeder, welche mittelst einer Trommel T ebenfalls unwandelbar an der Zeigerachse befestigt
ist; die Bewegung des Winkelhebels ist durch zwei Stifte begrenzt, damit er nicht
ganz zurückfallen, aber auch nicht zu tief zwischen die Nasen einfallen kann. Für
gewöhnlich ist also die Zeigerachse mit der Nasenscheibe und deren Zahnrade
verbunden, folgt also der Umdrehung dieser beiden oder der Kurbel. Ist aber eine
Taste niedergedrückt, so stößt, wenn der Arm Q an die
betreffende Stelle gelangt, erst die Feder f, dann der
Arm q an den Tastenhebel; dadurch wird die Wirkung der
Feder f aufgehoben und eine zweite, mit f an derselben Trommel T
befestigte Feder hebt den Sperrhaken des Winkelhebels aus der Nasenscheibe aus und
der Arm Q und die Zeigerachse folgen von jetzt nicht
mehr der Drehung der Nasenscheibe, bis eine andere Taste gedrückt wird, wodurch die
Feder f los gelassen wird und den Sperrhaken in die
Nasenscheibe wieder einrückt. Die Zahl der Nasen ist fast ganz gleichgültig, da die
Verbindung zwischen der Leitung und dem Inductor erst in dem Augenblicke hergestellt
wird, wo der Arm Q sich zu bewegen beginnt, und sofort
unterbrochen wird, wenn dieser Arm festgehalten wird. Zu diesem Behufe ist nämlich
auf die Zeigerachse ein Arm a lose aufgesteckt, der
durch drei Federn fest an die Trommel T der Feder f angedrückt wird, so daß er, so lange f und der Arm Q sich
bewegen, diesen folgt, bis sein über den Rand der Scheibe S merklich vorstehendes Ende n an eine
Contactschraube s¹ anstößt, während dasselbe, so
lange f und Q stillstehen,
durch eine messingene Spiralfeder an eine zweite Contactschraube s² herangezogen wird; s¹ ist mit dem Anfange, s² mit
dem Ende der Inductorwindungen leitend verbunden und außerdem führt von s² ein Draht nach dem Empfangsapparat und von da
zur Erde; der Arm a endlich ist durch die Metalltheile
des Apparates mit der Luftleitung in Verbindung. Liegt also n
an s², so ist die Leitung unmittelbar mit dem
Empfangsapparate in Verbindung; legt sich dagegen n an
s¹, so ist der Inductor zwischen Leitung und
Empfangsapparat eingeschaltet und nur während dieser Zeit können Inductionsströme
entstehen, weil außerdem das eine Ende der Inductorwindungen isolirt ist.
Der Zeichenempfänger enthält aufrecht zwei neben einander
stehende Elektromagnete mit stabförmigen Eisenkernen, in welchen die
Telegraphirströme zur Wirksamkeit gelangen. Die Kerne beider Elektromagnete sind an
beiden Enden mit Polschuhen versehen, deren Gestalt aus Fig. 18 ersichtlich ist;
zwischen ihnen befinden sich die Pole des permanent magnetischen Ankers. Derselbe
besteht aus zwei, in einer Verticalebene gebogenen und mit entgegengesetzt
gerichteten Polen mit ihren Rücken an einer verticalen Achse F befestigten Stahlmagneten; die Achse F liegt
zwischen den Elektromagneten, denselben parallel und dreht sich auf zwei
Schraubenspitzen. Es liegt also zwischen den unteren Polschuhen der Elektromagnete
der Nordpol des hinteren und der Südpol des vorderen Stahlmagnetes, zwischen den
oberen Polschuhen der Südpol des hinteren und der Nordpol des vorderen; daher wirkt
jeder durch die Rollen der Elektromagnete laufende Strom auf die beiden Hälften des
Ankers und oben wie unten in gleichem Sinne drehend ein und bewegt den Anker je nach
der Richtung des Stroms nach der einen oder anderen Seite gegen die Polschuhe hin.
Hört der Strom auf, so bleibt der permanent magnetische Anker in seiner Lage bei den
ihm nächsten Schenkeln der Polschuhe liegen. Ein zweiter Inductionsstrom von der
nämlichen Richtung wie der vorhergehende, bleibt ohne Wirkung auf die Lage des
Ankers; folgt aber ein Inductionsstrom von entgegengesetzter Richtung, so legt sich
der Anker auf die andere Seite, an die anderen Schenkel der Polschuhe. Es haben also
nur die Wechsel in der Richtung der Inductionsströme eine Bewegung des Ankers zur
Folge. Die Umsetzung der schwingenden Bewegung des Ankers in eine rotirende bewirkt
ein Sperrrädchen r (Fig. 19), und ein
Mitnehmer überträgt diese dann auf die Zeigerachse. Das Rädchen r sitzt auf einer Achse, welche sich mit seinen
Zapfenspitzen gegen zwei conische Rubinlager stützt, von denen das untere sich am
Ende eines an der Ankerachse F befestigten Armes h befindet, während das andere in die Unterseite eines
an der Zeigerachse befestigten kleinen Querstücks t
eingelassen ist. Die Zeigerachse selbst läuft in einem Halse in einem in der Mitte
der Buchstabenscheibe in dieselbe eingesetzten durchbohrten Rubinlager und endet
dicht unterhalb dieser Scheibe in dem Querstückchen t.
Zwei an diesem befindliche abwärts gerichtete Stifte umfassen einen an der Achse des
Rädchens r befestigten Arm und dienen als Mitnehmer für
die Zeigerachse. Gegen den Umfang des Rädchens r drücken
leicht zwei schwache Federn d und verhindern eine
zufällige Drehung desselben; ferner stehen zwei feine Stahlspitzen e auf beiden Seiten des Rädchens einander fast diametral
gegenüber, von denen stets die eine und die andere abwechselnd in die sägenförmigen
Zähne des Rädchens eingreift. Beim Hin- und Hergange des Ankers beschreibt nun der
Arm h und mit ihm das Rädchen r einen kleinen Bogen; letzteres wird dabei aus dem eben im Eingriffe
befindlichen Stifte ausgehoben und wälzt sich an den auf seinem Umfange schleifenden
Federn d etwas herum, bis der andere Stift auf der
anderen Seite in den nächstfolgenden Zahn eingefallen ist. Die Achse des mit 15
Zähnen versehenen Rädchens r dreht sich dabei um ein
halbes Zahnintervall, die Drehung wird durch den Mitnehmer auf die Zeigerachse
übertragen und der Zeiger rückt um ein Feld weiter. Dasselbe geschieht, so oft ein
Wechsel in der Richtung der Inductionsströme eintritt.
Außerdem ist eine Vorrichtung vorhanden, mittelst deren man den Zeiger nach Bedarf
mechanisch fortbewegen kann. Endlich ist ein Lärmapparat (Wecker) vorhanden, welcher
mittelst eines Kurbelumschalters beliebig eingeschaltet werden kann.
Tafeln