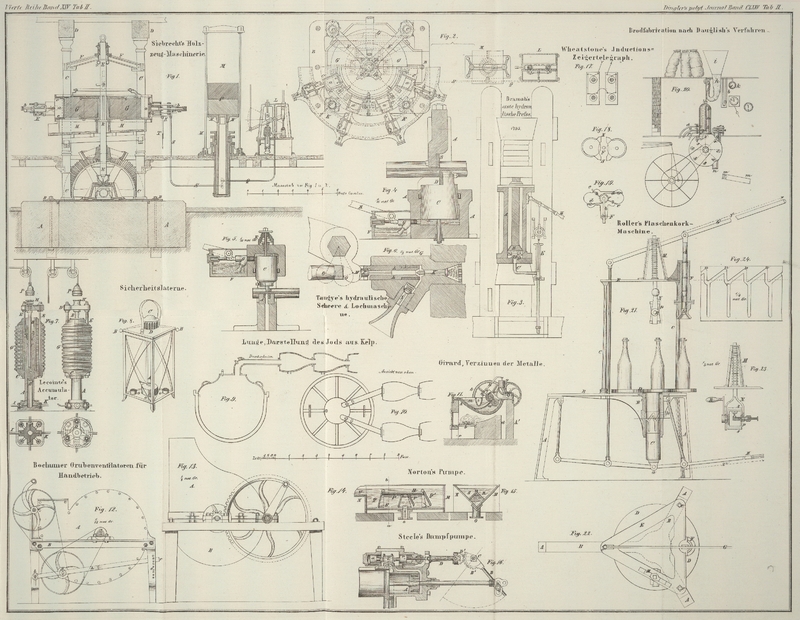| Titel: | Ueber die Darstellung des Jods und anderer Producte aus Kelp in Schottland; von Dr. Lunge. |
| Fundstelle: | Band 175, Jahrgang 1865, Nr. XXXVI., S. 148 |
| Download: | XML |
XXXVI.
Ueber die Darstellung des Jods und anderer
Producte aus Kelp in Schottland; von Dr. Lunge.
Aus dem Breslauer Gewerbeblatt, 1864, Nr.
25.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Lunge, über Darstellung des Jods und anderer Producte aus Kelp in
Schottland.
Es wurde mir in Glasgow durch die Güte des Besitzers Gelegenheit geboten, die
bedeutendste der dortigen Jodfabriken auf das Genaueste zu besichtigen und jede
gewünschte Auskunft über die Art und Weise der Fabrication zu erhalten. Ich
überzeugte mich, daß in dieser Fabrik, welche allein mehr Jod als alle übrigen
schottischen Fabriken zusammengenommen erzeugt, ein theilweise ganz anderes
Verfahren befolgt wird, als man es noch in den neuesten Lehrbüchern beschrieben
findet; die Verfasser der letzteren scheinen eine der anderen, kleineren Fabriken
vor Augen gehabt zu haben. Eine Beschreibung jener Fabrik dürfte also hier am Orte
seyn; ich will derselben jedoch zunächst einige allgemeine Angaben über das
Rohmaterial dazu vorausschicken, welche ich dem Hofmann'schen Berichte der Ausstellungs-Jury von 1862 auszüglich entnehme.
Bekanntlich verarbeiten die Jodfabriken Kelp oder Varec, d.h. die Asche gewisser
Seetange, welche in ungeheuren Mengen, namentlich an den Küsten von Schottland,
Irland und Frankreich gesammelt und verbrannt werden. Diese Seetange (Algen) sind
aber nicht alle von derselben Art, und namentlich besteht ein sehr bedeutender
Unterschied zwischen „Treibalgen“
Ich erlaube nur diese Wortbildung nach Analogie von Treibholz. (engl. drift weed, franz. varec venant und „Schnittalgen“ (engl. cut weed, franz. varec
scié. Die ersteren treiben dem Lande auf den Wellen zur Fluthzeit
zu, oder werden auf offener See von den Bootsleuten aufgefischt; die letzteren
sitzen an den Felsen fest und müssen abgeschnitten, also wirklich geerntet werden.
Letztere, die Schnittalgen, gehören zu den botanischen Arten Fucus serratus welche schwarz ist, und Fucus
nodosus, von gelber Farbe. Die erstere ist um die Hälfte reicher, sowohl an
Kalisalzen, als an Jod, als die letztere.
Die Treibalgen bestehen aus der Art Laminaria digitata;
sie enthalten 25 Procent mehr Kalisalze und 300 Proc. mehr Jod, als die
Schnittalgen; außerdem ist das Verhältniß der Kali- zu den Natronsalzen günstiger und endlich enthalten
sie von ersteren meist Chlorkalium, während in den Schnittalgen schwefelsaures Kali
vorwiegt, dessen Handelswerth geringer als der des Chlorkaliums ist. In jeder
Beziehung also haben die Treibalgen den Vorzug vor den Schnittalgen, und daraus
erklärt es sich, daß der Kelp der westlichen Provinzen Großbritanniens und Irlands
besser ist, als der der östlichen; den ersteren führt nämlich der atlantische Ocean
und die dort viel heftigeren Winde eine große Menge Treibalgen zu, während die
letzteren meist auf Schnittalgen angewiesen sind. Der Unterschied im Werthe ist sehr
groß; so kostet z.B. Rathlin Kelp in Glasgow 7 Pfd. St. 10 Sh. bis 10 Pfd. St. 10
Sh. per Kelptonne von 22 1/2 Centner, während Galway
Kelp nur 2 bis 3 Pfd. St. bringt.
In welch unrationeller Weise der Kelp dargestellt wird, und welche enorme Quantität
namentlich von Jod, bei der Verbrennung der Algen durch Verflüchtigung verloren
geht, ist allgemein bekannt und in dem Hofmann'schen
Berichte speciell besprochen, wo auch einige der vielen Verbesserungsvorschläge
entwickelt und zugleich die Ursachen angeführt sind, welche eine durchgreifende
Abhülfe sehr erschweren, wenn nicht unmöglich machen. Es würde mich zu weit führen,
hier darauf einzugehen, und will ich nur einen dieser Uebelstände erwähnen, nämlich
den, daß bei der Verbrennung die Schwefelsäureverbindungen zu Schwefelverbindungen
reducirt werden, und nachher wieder aus den letzteren durch Zusatz von Schwefelsäure
regenerirt werden müssen, was die Hälfte der Kosten der ganzen Kelpverarbeitung
ausmacht. 22 Tonnen (à 20 Ctr.) nasser Tang geben
durchschnittlich eine Tonne drift kelp, aus welcher
neben Jod und gemischten Natronsalzen 5 bis 6 Ctr. Chlorkalium (des Handels) und 3
Ctr. rohes schwefelsaures Kali erhalten werden. Die ganze Behandlung des Kelp kostet
zwischen 25 und 28 Sh. per Tonne, wovon allein 13 Sh.
auf Schwefelsäure kommen.
Die von mir besuchte Fabrik von Wm. Paterson in Glasgow
verarbeitet 10,000 bis 12,000 Tonnen irischen Kelp im Jahre. Die Qualität desselben
ist sehr verschieden, und der Gehalt an löslichen Bestandtheilen schwankt zwischen
30 und 60 Procent. Die löslichen Salze werden gewonnen durch Auslaugen des Kelps in
gußeisernen, viereckigen Gefäßen (keeves) von 8 Fuß
Länge, 5 Fuß Breite, 4 Fuß Höhe und 5/8 Zoll Eisenstärke. Sie bestehen aus einzelnen
Platten mit rechtwinklig abstehenden Rändern, welche durch Schraubenbolzen vereinigt
sind; die Langseite ist aus zwei solchen Platten zusammengesetzt. Oben sind sie
offen, haben aber einen 3 Zoll breiten, nach innen gehenden Rand, welcher dem
Herausspritzen von Flüssigkeit vorbeugen soll. Mit Doppelboden sind sie nicht versehen, sondern
haben nur gerade über der Oeffnung im Boden für den Ablaßhahn ein grobes Filter,
bestehend aus Kieselsteinen, darüber ausgelaugtem Kelp und zuoberst einem Stücke
grober Leinwand. Ein solcher gußeiserner Bottich mit allem Zubehör kostet 30 Pfd.
St.
Je 20 solcher Bottiche sind zu einem Systeme verbunden. Es führen nämlich von ihren
Ablaßhähnen Rinnen oder Röhren zu einem gemeinschaftlichen Sumpfe, welcher den
Inhalt eines Bottiches faßt; in ihm steht eine gußeiserne Druckpumpe, deren
Druckrohr wiederum Abzweigungen über alle Bottiche aussendet. Man läßt also die
Flüssigkeit aus einem der Bottiche in den Sumpf laufen, und pumpt sie von da, wenn
sie siedewürdig ist, nach einem Sammelgefäße, wenn aber nicht, in einen anderen
Bottich, dessen Flüssigkeit früher entleert worden ist. Selbstverständlich geschieht
dieß in systematischer Reihenfolge, welche um so nothwendiger ist, als der Kelp 20
oder mehr Wässer bekommen muß, bevor er erschöpft ist. Die Laugen sind alle kalt,
und nur zum letzten Auslaugen wird warmes Wasser aus einem Dampfkessel genommen;
Dampfröhren für jeden einzelnen Bottich sind nicht vorhanden. Wie man sieht, ist das
ganze Verfahren sehr verbesserungsfähig; jeder Bottich muß einzeln in den Sumpf
entleert und die Flüssigkeit wieder aus diesem herausgepumpt werden, während bei dem
jetzt allgemein in den Sodafabriken angewendeten Verfahren von Shanks das Füllen eines Bottichs mit frischem Wasser die selbstthätige
Wanderung der Laugen durch alle Bottiche veranlaßt. Zwar muß man sich dabei auf die
Combination von wenigen Bottichen beschränken (gewöhnlich werden nur bis zu sechs
davon angewendet); diese würden aber wohl auch für den Kelp ausreichen, wenn man die
Art der Filtration verbesserte, und in den Bottichen doppelte falsche Böden, wie in
den Sodafabriken, anbrächte.
Wenn der Kelp völlig ausgelaugt ist, so wird der Rückstand auf Haufen geworfen und
der Austrocknung an der Luft überlassen; er wird von den Verfertigern von
Flaschenglas angekauft, für welche er vermuthlich wegen seines Gehaltes an
kieselsaurem Kalke Werth hat. Andererseits wird die Lauge, wenn sie völlig gesättigt
ist, in einen großen schmiedeeisernen Behälter gepumpt, welcher höher als die
Siedepfannen angebracht ist, und die letzteren speist. Von Siedepfannen sind 6 Stück
vorhanden, welche jede durch ein besonderes Feuer geheizt werden; sie sind von
Gußeisen, haben 8 Fuß Durchmesser und 5 Fuß Tiefe; die Eisenstärke ist am Boden 2
Zoll, nimmt aber nach dem Rande hin allmählich ab, so daß eine solche Pfanne nicht
mehr als 35 Centner wiegt. Der Rost hat 3 Fuß Länge und Breite, und ist so
angebracht, daß der Boden der Pfanne sich noch im Mauerwerke befindet, und nur die Seiten vom Feuer
bestrichen werden; dieß geschieht, um das Springen zu verhüten, welches sonst sehr
leicht erfolgen könnte, weil sich immer eine Menge Salze am Boden festsetzen. (Hier
muß ich wieder die Bemerkung machen, daß man wohl weit zweckmäßiger die sogenannten
bootförmigen Pfannen anwenden würde, welche sich bei der Fabrication von caustischer
Soda so ausgezeichnet zweckentsprechend für einen ähnlichen Proceß bewährt haben,
und deßhalb in England allgemein eingeführt sind.) Das Feuer also, welches sehr
stark unterhalten wird, geht um die Seiten des Kessels herum, und dann zwischen je
zwei Pfannen hindurch nach einem gemeinschaftlichen Zugcanale, welcher nach dem
Hauptschornstein führt, nachdem er vorher noch unter dem Laugenreservoir hingegangen
ist und dieses erwärmt hat. Das Register zur Regulirung des Zuges befindet sich in
sehr bequemer Weise dicht neben der Feuerthür. Die Pfannen liegen so hoch, daß man
die Lauge aus ihnen durch Rinnen in alle Krystallisirgefäße laufen lassen kann; man
muß die Lauge aus ihnen in die Rinnen ausschöpfen, da sie keine Ablaßöffnung
haben.
Die Kelplauge wird zunächst so weit eingedampft, daß beim Erkalten alles
schwefelsaure Kali herauskrystallisirt. Eine bestimmte Grädigkeit kann man dafür
nicht angeben, da das Verhältniß der verschiedenen Salze zu einander ungemein
wechselnd ist; die Arbeiter haben dafür praktische Anzeichen, z.B. die Bildung eines
Salzhäutchens im Sieden. Bei dem richtigen Punkte also zieht man das Feuer aus und
läßt die Lauge zum Erkalten in die Krystallisirgefäße laufen. Diese sind sämmtlich
von Gußeisen, theils halbkugelige Schalen von 6 Fuß Durchmesser, theils Cylinder von
4 1/2 Fuß Durchmesser und 4 Fuß Höhe, die Eisenstärke beider ist 5/8 Zoll. Die
Cylinder sollen sich zweckmäßiger als die Schalen zeigen, wahrscheinlich weil wegen
der größeren Oberfläche das Erkalten rascher stattfindet. Man läßt mehrere Male
hintereinander in demselben Gefäße krystallisiren, bis die Krystallkruste eine Dicke
von mindestens 2 Zoll erreicht hat.
Bei der ersten Krystallisation scheidet sich also rohes schwefelsaures Kali aus,
welches man nur durch Ablaufenlassen von der Mutterlauge trennt und feucht als plate sulfate in den Handel bringt. Es enthält 50
Procent schwefelsaures Kali, 30 Procent schwefelsaures Natron und Kochsalz nebst
etwas von den übrigen Kelpsalzen, und 20 Proc. Wasser; sein Preis ist etwa 7 Pfd.
St. per Tonne (2 1/3 Thlr. per Centner).
Die Mutterlauge, welche davon bleibt, wird in den oben beschriebenen Pfannen weiter
eingedampft, bis trotz des Ausschöpfens der fortwährend herausfallenden Natronsalze
auch Kalisalze als Haut an der Oberfläche zu krystallisiren anfangen; man schöpft dann
wieder aus und erhält jetzt beim Erkalten eine Ernte von Chlorkalium. Die davon
fallende Mutterlange wird wieder weiter eingedampft, unter Ausschöpfung der sich
während des Siedens ausscheidenden Natronsalze; beim Krystallisiren erhält man eine
zweite Ernte von Chlorkalium. Auf ganz dieselbe Weise erfolgt noch eine dritte, oft
noch eine vierte Krystallisation von Chlorkalium. Dieses Salz läßt man zunächst in
eisernen Ständern nach Art der Auslaugebottiche abtropfen und wäscht es mehrere Male
mit kaltem Wasser ab, weil die Mutterlaugen durch ihren zunehmenden Jodgehalt immer
werthvoller werden. Dann läßt man es noch auf einer schiefen hölzernen Ebene 24
Stunden lang in dünner Schicht ausgebreitet ablaufen, und trocknet es zuletzt auf
einem von feuerfesten Platten gebildeten Raume von 15 Fuß Länge und 8 Fuß Breite,
welcher durch zwei darunter angebrachte Feuerungen geheizt wird. Das käufliche Salz
enthält 92–93 Procent Chlorkalium, 2 Proc. Wasser und 5–6 Proc. fremde
Salze, besonders Chlornatrium (diese Angabe wurde mir in völlig verläßlicher Weise
bei Paterson gemacht; Hofmann
gibt 80 Proc. Chlorkalium und 8–9 Proc. Wasser an). Der Handelspreis war nach
Hofmann im Jahre 1862 20 Pfd. St. per Tonne (= 6 2/3 Thlr. per
Centner), dürfte aber seit der gesteigerten Ausbeute des Staßfurter Lagers bedeutend
gefallen seyn.
Die Natronsalze (kelp salt), welche sich in enormer Menge
während des Eindampfens ausscheiden und mit durchlöcherten Schaumlöffeln ausgesoggt
werden, bestehen zum größten Theile aus Kochsalz, nächstdem aus schwefelsaurem und
kohlensaurem Natron; außerdem enthalten sie immer etwas Kalisalze beigemengt. Das
Salz wird feucht auf Lager gebracht und in dem Feuchtigkeitszustande, den es gerade
hat, verkauft; trotzdem bringt es 18 Sh. per Tonne,
während ganz reines Kochsalz in Glasgow nur mit 13 Sh. bezahlt wird. Dieß kommt
daher, daß es die Sodafabrikanten wegen seines Gehaltes an Soda gern kaufen und zur
Beimischung für geringere Sodasorten benutzen. Beiläufig gesagt, kostet in Liverpool
trockenes, schneeweißes, völlig reines Kochsalz von Nord-Wales 6 Sh. per Tonne oder 3 Sgr. per
Centner, was freilich den dortigen Fabrikanten eine Concurrenz mit denen anderer
Orte sehr leicht macht.
Die jährliche Ausbeute an gemischten Natronsalzen ist in dieser Fabrik 5000 Tonnen
(à 20 Centner), an Chlorkalium 2500 Tonnen,
welche sämmtlich nach Salpeterfabriken gehen, und an schwefelsaurem Kali 1500
Tonnen.
Die Mutterlauge, welche nach der letzten Krystallisation von Chlorkalium bleibt, wird
nun auf Jod verarbeitet. Sie enthält neben Jodkalium und Jodnatrium Verbindungen der
Alkalien mit Schwefelwasserstoff, schwefliger Säure und unterschwefliger Säure. Sie
wird in große Behälter gepumpt, welche durch hölzerne Deckel dicht verschlossen
sind; ein weites thönernes Ableitungsrohr für Gase ist in dem Deckel angebracht und
mündet in einen Zugcanal, welcher in den 175 Fuß hohen Hauptschornstein führt. In
diesen Gefäßen wird die Mutterlauge mit so viel Schwefelsäure versetzt, bis alle
flüchtigen Schwefelverbindungen ausgetrieben sind und noch ein bestimmter Ueberschuß
von Schwefelsäure vorhanden ist, welcher alkalimetrisch ermittelt wird. Die
Schwefelsäure (von 1,70 spec. Gew.) fließt aus den Ballons, welche auf dem Deckel
stehen, durch einen dünnen Heber von Gutta-percha in feinem Strahle allmählich zu.
Zuerst zersetzen sich hauptsächlich die Schwefelalkalien, dann mehr die
schwefligsauren und unterschwefligsauren Alkalien; daher herrscht zuerst der Geruch
nach Schwefelwasserstoff, dann der nach schwefliger Säure vor. Die Gase gehen
sämmtlich unbenutzt nach dem Schornstein. Natürlich scheidet sich auch eine Menge
Schwefel als solcher ab, theils entstanden durch das Zerfallen der unterschwefligen
Säure, theils durch die gegenseitige Wirkung des Schwefelwasserstoffs und der
schwefligen Säure; er zeigt sich als eine Art Schaum in häufig fußdicker Lage an der
Oberfläche der Flüssigkeit, wird von dieser abgenommen und lufttrocken an
Schwefelsäurefabrikanten abgegeben. Die jährliche Ausbeute ist 100 Tonnen = 2000
Centner, mit 75 Procent Gehalt an reinem Schwefel. Der Verbrauch an Schwefelsäure
ist sehr wechselnd und manchmal das 3- bis 4fache von der Menge, welche man bei
einer guten Kelpsorte braucht. Dieß scheint sich mir ganz einfach daraus zu
erklären, daß bei einer besseren, d.h. an krystallisirbaren Kalisalzen reicheren
Kelpsorte weniger schwefelsaures Kali bei der Verbrennung der Algen reducirt worden
ist.
Wenn die mit Schwefelsäure versetzte Flüssigkeit 24 Stunden gestanden und jede
Gasentwickelung aufgehört hat, wird sie, natürlich nach Abschäumung des Schwefels,
in die Sublimirgefäße gebracht, welche 5 an der Zahl, unmittelbar davor stehen. S.
Fig. 9 und
10.
Jedes von diesen besteht aus einem gußeisernen Kessel von 5 Fuß Durchmesser und einem
darauf gekitteten, aus Blei dick gegossenen Helme, welcher ziemlich halbkugelig
gewölbt ist und in der Mitte eine kreisrunde Oeffnung von 1 1/2 Fuß Durchmesser hat.
Ein Gerüst von eisernen, mit Blei überzogenen Stäben in seinem Innern schützt ihn
vor dem Zusammenfallen. Ein solcher Helm dauert nur wenige Monate, und auch der
gußeiserne Untertheil nützt sich rasch ab, besonders einige Zoll unter dem Rande,
nämlich über dem Niveau der Flüssigkeit. Als Kitt für die bleibende Verbindung
zwischen dem eisernen Untertheil und dem Bleihelme nimmt man Romancement, während
alle übrigen, temporären Lutirungen mit nassem Thon gemacht werden. Die kreisrunde
Oeffnung in der Mitte des Helmes wird mit einer dreifach durchlöcherten Thonplatte
bedeckt. Das eine dieser Löcher hat einen Zoll im Durchmesser und ist mit einem
thönernen Pfropfen verschlossen; es dient zum Einbringen von Braunstein. Die beiden
anderen Löcher haben 3 Zoll im Durchmesser; in sie werden die thönernen
Ableitungsröhren für den Joddampf eingekittet. Diese letzteren sind knieförmig
gebogen, haben gleichfalls eine Oeffnung mit Thonpfropf und eine Handhabe. Sie
stehen wieder in Verbindung mit den Recipienten, flaschenförmigen Gefäßen von
Thonmasse, etwa 2 1/2 Fuß lang und 1 Fuß im Bauche dick. Sie liegen waagrecht und
zwar immer sechs hintereinander, indem immer der Hals der nächsten in den Boden der
ferneren reicht; zu einem Apparate gehören also im Ganzen zwölf Vorlagen. Sie haben
gar keinen festen Boden, weil man sonst die Kuchen des sublimirten Jods nicht gut
herausnehmen könnte; der Zwischenraum zwischen dem engen Halse der einen Flasche und
dem viel weiteren Bodenrande der anderen ist durch einen Ring von gebranntem Thon
ausgefüllt, welcher mit Falzen in beide eingreift und durch nassen Thon mit ihnen
verkittet wird. Jede Flasche hat an der unteren Seite eine kleine Oeffnung, welche
stets offen bleibt, damit das bei der Sublimation mit übergehende und sich
condensirende Wasser abtropfen kann. Die letzte Flasche ist verschlossen; übrigens
entweicht, auch wenn sie geöffnet wird, nur eine höchst unbedeutende Menge Joddampf
daraus. In dieser Vorlage findet sich häufig Jodcyan in weißen Nadeln mit dem Jod
angeschossen.
Die mit Schwefelsäure versetzte Mutterlauge wird also in den Apparat gebracht, dann
die Thonplatte und in diese die Ableitungsröhren eingekittet, und die Verbindungen
der Flaschen mit denselben und untereinander hergestellt. Darauf wird ein schwaches
Feuer unter der Blase angezündet und durch das kleine Loch im Deckel Braunstein in
kleinen Portionen nach und nach zugegeben; im Ganzen braucht man einen Centner davon
für jeden Apparat. Nach 10 Stunden ist alles Jod ausgetrieben, soweit möglich, und
die Sublimation beendet; alle 24 Stunden wird eine solche Operation gemacht. Das
Feuer bestreicht nur den Boden des Kessels, welcher letztere jedoch zur Verringerung
der Abkühlung ganz eingemauert ist. Das während der Sublimation mit übergehende und
aus den Vorlagen abtropfende Wasser enthält etwas Jod und wahrscheinlich alles Brom;
es wird immer wieder in die Kessel zurückgegossen. Bis jetzt wird in Schottland noch
kein Brom für sich abgeschieden; es dürfte sich dieses auch schwerlich lohnen, da nicht nur
seine Trennung vom Jod sehr schwierig, sondern auch die im Kelp vorkommende Menge
sehr unbedeutend ist.
Wichtiger vielleicht wäre es, ein Mittel zu finden, um den so bedeutenden Verbrauch
an Schwefelsäure zu verringern. Man hat z.B. vorgeschlagen, die Säure ganz verdünnt
einfließen zu lassen, wo sich dann zuerst fast nur die Schwefelalkalien zersetzen;
man solle mit dem Zusatze von Säure aufhören, wenn statt des Schwefelwasserstoffes
schweflige Säure zu entweichen anfängt. Dann solle man die Flüssigkeit mit Schwefel
kochen, um alles schwefligsaure Salz in unterschwefligsaures überzuführen, welches
letztere bekanntlich weit weniger löslich ist. Beim Erkalten würde es also
größtentheils herauskrystallisiren. Bei diesem Verfahren würde man somit erstens
alle Schwefelsäure ersparen, welche zur Zersetzung der schwefligsauren und
unterschwefligsauren Alkalien erforderlich ist, und zweitens eine bedeutende
Quantität der letzteren gewinnen. Die Mutterlauge würde dann mit so viel
Schwefelsäure zu versetzen seyn, um den Braunstein zu zersetzen, und käme zu
derselben Verarbeitung wie eine gewöhnliche Mutterlauge. Ob dieses Verfahren,
welches mir bei Hrn. Paterson als Vorschlag mitgetheilt
wurde, in der Praxis irgendwo ausgeführt wird, ist mir nicht bekannt geworden; in
jener Fabrik selbst wird es nicht angewendet, sondern ebenso verfahren, wie es
beschrieben worden ist. Man hat somit in dem Rückstande aus den Sublimirgefäßen eine
viel freie Säure enthaltende Lösung von schwefelsauren Alkalien, welche an einen
Düngerfabrikanten abgegeben wird.
Die jährliche Ausbeute an Jod beträgt 35 Tonnen oder 78,400 Pfund engl. Der
Handelspreis desselben ist ungemein schwankend; er beträgt jetzt ungefähr 8 Sh. per Pfund, war aber schon über 30 Sh., und andererseits
wenig über 4 Sh. Das englische Jod wird erheblich theurer, als das französische
bezahlt, obwohl das letztere in seinen krystallinischen Blättern schöner, als das
erstere aussieht; es ist aber weniger rein und enthält namentlich mehr Wasser, da es
bekanntlich durch nasse Fällung dargestellt wird.
Tafeln