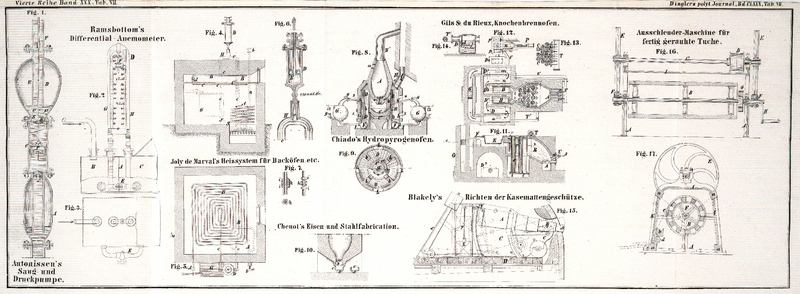| Titel: | Knochenbrennofen von Gits und du Rieux. |
| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. XCIX., S. 359 |
| Download: | XML |
XCIX.
Knochenbrennofen von Gits und du Rieux.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Gits und du Rieux's Knochenbrennofen.
Die Darstellung der Knochenkohle geschieht jetzt allgemein durch Verkohlen der
Knochen in Töpfen; verschiedene Systeme continuirlicher Oefen sind versucht, aber
wieder aufgegeben worden, theils weil sie sich sehr rasch abnutzten, theils weil sie
keine befriedigenden Resultate lieferten alle entwickelten mehr oder weniger die
bekannten höchst unangenehm riechenden Gase. Von allen diesen Uebelständen soll der
continuirliche Brennofen von Gits und du Rieux in Lille frei seyn, der in Fig. 11 im verticalen
Durchschnitt nach der Mitte und in Fig. 12 im horizontalen
Durchschnitt nach der gebrochenen Linie 1, 2, 3 der Fig. 11 dargestellt
ist.
Der Ofen besteht aus einer seitlichen Feuerung mit Verbrennungsraum B; die verticalen Brenncylinder C sind oben durch Röhren c mit dem
horizontalen, auf der Ofenmauerung liegenden Rohre T
verbunden (Fig.
11 und 13). Aus diesem Rohre gelangen die in den Cylindern entwickelten Gase durch ein
gekrümmtes Rohr F' (Fig. 12) in ein erstes
Waschgefäß D (punktirt in Fig. 12 und für sich in
Fig. 14
dargestellt). Die Knochen werden, bevor sie in die Cylinder gebracht werden, in den
Gefäßen E entfettet und über den Zügen a, in denen sich die Feuerungsgase in der Richtung der
Pfeile Fig.
12 bewegen, getrocknet. An die Brenncylinder schließen sich unten
Blechröhren c' an, in welchen die gebrannten Knochen
allmählich abkühlen, um dann mittelst der Schieber e
entfernt zu werden.
In den gußeisernen Waschgefäßen D, D' etc. befindet sich,
wie Fig. 14
zeigt, eine rechtwinkelige Scheidewand d, welche die
eintretenden Gase zwingt, durch die in den Gefäßen enthaltene Flüssigkeit zu gehen.
Das dazu nöthige Saugen wird durch die von der Dampfmaschine P betriebenen Pumpen p und p' bewirkt. Von diesen Luftpumpen werden dann die
angesaugten Gase durch das Rohr U nach der Feuerung
gedrückt, die dazu an der Vorderseite mit drei Düsen u
versehen ist; hier werden die Gase fast vollständig verbrannt und liefern einen
großen Theil der zum Verbrennen der Knochen nöthigen Wärme. Von den Waschgefäßen
enthalten die drei ersten ein Gemisch von gleichen Theilen Wasser und Schwefelsäure,
die zwei letzten eine Eisenvitriollösung. In den ersteren erhält man eine Lösung von
schwefelsaurem Ammoniak, in den letzteren werden die kleinen Mengen der stark
riechenden Cyanverbindungen absorbirt, die nicht von der Schwefelsäure aufgenommen
worden waren. Das schwefelsaure Ammoniak läßt sich durch Abdampfen der Flüssigkeit
leicht und ohne Geruch gewinnen; die cyanhaltige Lösung kann auf Berlinerblau
verarbeitet oder als Dünger verkauft werden. (Nach Armengaud's
Génie industriel, Februar 1866, S. 100; aus der
deutschen Industriezeitung, 1866, Nr. 14.)
Tafeln