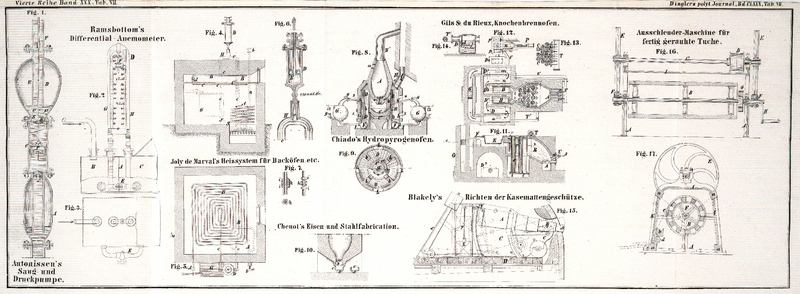| Titel: | Der Hydropyrogen-Ofen und seine Anwendung zum Zugutemachen der Kupfererze; von D. Chiado. |
| Fundstelle: | Band 180, Jahrgang 1866, Nr. C., S. 360 |
| Download: | XML |
C.
Der Hydropyrogen-Ofen und seine Anwendung
zum Zugutemachen der Kupfererze; von D. Chiado.
Aus Armengaud's Génie industriel, April 1866, S.
158.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Chiado's Hydropyrogen-Ofen.
Dieser, vom Erfinder Hydropyrogen-Ofen (four
pyro-hidrogénique) benannte Apparat besteht:
1) aus zwei Oefen, einem Krummofen und einem Flammofen; der erstere liegt über dem letzteren, so daß
beide nur einen einzigen Ofen bilden;
2) aus einer durch den Ofen selbst erhitzten Aeolipile,
oder einem Generator, welcher zwei oder mehrere Strahlen
von Wasserdampf erzeugt, die auf die zu verhüttenden Erze hinwirken; letztere fallen
nach gehöriger Vorbereitung aus dem Krummofen in den Flammofen hinab.
Durch die chemische Einwirkung des Wasserdampfes auf die Erze läßt sich mittelst
eitles einzigen Processes und mit einem im Verhältniß zu den bisher üblichen
Methoden sehr geringen Zeitaufwande direct gares Kupfer darstellen, welches in den
Handel gebracht werden kann, ohne erst noch raffinirt werden zu müssen. Dieses
Resultat wird augenscheinlich durch die besondere Einrichtung und die gleichzeitige
Wirkung der beiden Oefen bedingt; denn das im Krummofen vorbereitete Erz gelangt von
selbst nach der erforderlichen Zeit, ohne die geringste Temperaturerniedrigung, in
den Flammofen, und die Einwirkung der Hitze des letzteren auf das Erz beginnt in
demselben Momente, in welchem es aus dem Krummofen in ihn hinabfällt, wodurch
natürlich an Zeit und Brennmaterial erspart wird.
Fig. 8 stellt
eine Seitenansicht des neuen Ofens mit der Aeolipile oder dem Dampfgenerator
dar.
Fig. 9 ist ein
Grundriß des Ofens, und zwar in der oberen Hälfte im Durchschnitte nach der Linie
1–2, also beinahe in der Ebene des Reductionstiegels oder Sumpfes, in der
unteren Hälfte hingegen im Durchschnitte nach der Linie 3–4, an der Basis des
Krummofens.
Die aus den zugute zu machenden Erzen und Holzkohle bestehende Beschickung wird durch
die kleine Thür a in den Krummofen A aufgegeben. Unter diesem liegt der Flammofen B, in welchen das Brennmaterial kommt; in demselben sind
vier oder noch mehr Widerlager angebracht, welche den Krummofen tragen. Das durch
die Stichöffnungen a', a' (welche gleichzeitig zur
Beförderung der Verbrennung in diesem Theile des Flammofens dienen) ablaufende
Schwarzkupfer fließt in den Tiegel C, welcher in einem
zweiten Tiegel C' steht; letzterer dient zur Aufnahme
der beim Raffiniren abzuziehenden Schlacke.
Das Brennmaterial liegt auf dem Roste D, D und wird durch
die sehr genau und dicht schließenden Thüren b', b'
aufgegeben. Die Kessel oder Generatoren F, F, welche den
Aeolipilen oder Dampfkammern den Dampf zuführen, liegen unter diesem Roste. Diese
Aeolipilen oder Dampfkammern G, G sind mit
Sicherheitsventilen und Düsen, und die letzteren mit Hähnen g, g versehen, welche die Dampfströme in den Ofenraum
leiten.
H, H' sind die Essen der beiden Oefen, welche in eine
größere gemeinschaftliche Esse münden. H ist mit einem
Register h versehen, mittelst dessen sich der Zug des
Flammofens reguliren läßt.
Das flüssige Kupfer wird durch die Stichlöcher I, I
abgestochen und in Rosetten gegossen; dann wird die Asche entfernt und Luft
zugelassen, um den Verbrennungsproceß in beiden Oefen zu unterhalten. Die von dem
Tiegel C abgezogenen Schlacken werden durch die
Schlackenthüren L, L entfernt.
Betriebsweise des Hydropyrogen-Ofens. –
Zunächst wird der ganze Apparat gehörig abgewärmt; dann wird die aus den
abgerösteten Erzen und Holzkohle bestehende Beschickung in den Krummofen
aufgegeben.
Ist der letztere fertig beschickt, so wird tüchtig geschürt, bis das Schwarzkupfer
durch die Abstiche a', a' in den Tiegel C des Flammofens zu fließen beginnt. Der Tiegel ist zur
Aufnahme des Metalles bereits abgewärmt, denn er ist von dem Feuer umgeben, welches
durch das von Zeit zu Zeit durch die Oeffnungen b', b'
aufgegebene Brennmaterial unterhalten wird.
In diesem Stadium des Processes müssen die Hähne g, g
geöffnet werden, so daß der Wasserdampf auf das im Tiegel bereits angesammelte
Schwarztupfer strömt; letzteres geräth dann in's Kochen, die Schlacken schwimmen auf
der Oberfläche des flüssigen, durch die Einwirkung des Wasserdampfes gegarten
Kupfers, indem sich letzteres in Folge seines größeren specifischen Gewichtes im
unteren Theile des Tiegels hält; die Schlacken werden mittelst eines Hakens
abgezogen und sobald sich eine genügende Menge Garkupfer angesammelt hat, wird in
die Formen abgestochen.
Da aber die beiden Oefen in continuirlichem Betriebe stehen, so darf das Aufgeben der
Beschickung nicht eher unterbrochen werden, als bis der ganze Erzvorrath reducirt
ist, oder bis nach mehrtägigem ununterbrochenem Betriebe der Ofen selbst einer
Reparatur bedarf.
Die mit einem solchen Apparate von mittleren Dimensionen in einem Lande, wo die
Brennmaterialien nicht billig sind, erhaltenen Resultate sind folgende: vollständige
Reduction des in 1 metrischen Centner (= 2 Zollcentner) Kies von beliebigem
Kupfergehalte enthaltenen Kupfers zu verkäuflichem Garkupfer, und zwar binnen einer
Arbeitszeit von 5 Stunden mit einem Brennmaterial-Aufwande von 4 Francs (= 1
Rthlr. 2 Sgr.). Im
Verhältniß zu den mittelst der bisher angewendeten Verhüttungsmethoden erzielten
Resultaten ist dieß ein sehr günstiges Ergebniß in Bezug auf die Ersparniß sowohl an
Zeit als an directen Geldkosten.
Tafeln