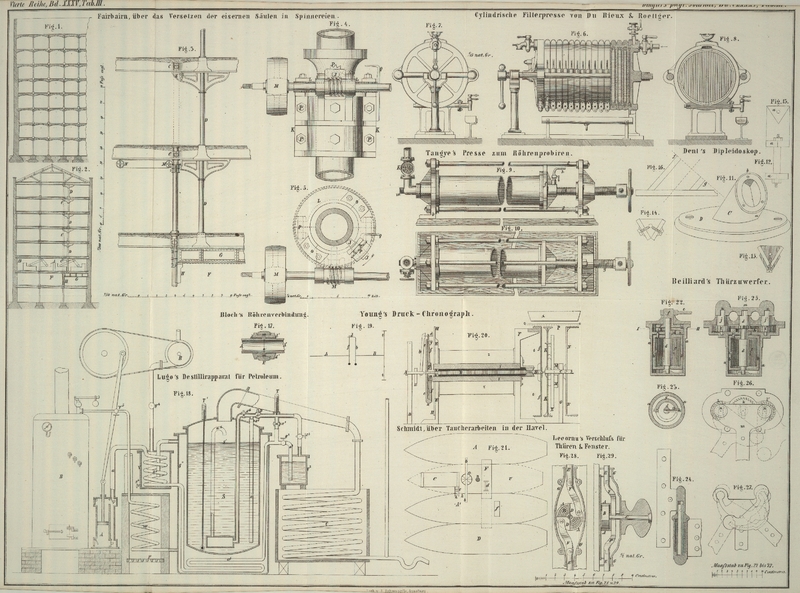| Titel: | Lugo's Destillirapparat für Petroleum; von Adolph Ott, Techniker in New-York. |
| Fundstelle: | Band 185, Jahrgang 1867, Nr. LVII., S. 195 |
| Download: | XML |
LVII.
Lugo's Destillirapparat für Petroleum; von Adolph Ott, Techniker in
New-York.
Mit einer Abbildung auf Tab. III.
Lugo's Destillirapparat für Petroleum.
Dieser Apparat, welcher sowohl in Nordamerika als in mehreren europäischen Staaten
patentirt ist, gründet sich auf die Anwendung überhitzten Dampfes zur Erwärmung der
Blasenfüllung, sowie auf diejenige eines Luftstromes zum Uebertreiben der aus der
letzteren sich entwickelnden Dämpfe. Die Vortheile, welche hierdurch erzielt werden,
sind namentlich folgende: Es wird dem so häufig vorkommenden Durchbrennen der
Kesselböden, gewöhnlich die Ursache der Zerstörung von Petroleumraffinerien,
gänzlich vorgebeugt; die Anwendung von Wärme ist vollkommen unter der Controle des
Destillateurs; es werden die aus der zu destillirenden Flüssigkeit aufsteigenden
Gase (durch die Lufteinströmung) in demselben Maaße fortgeleitet als sie sich
bilden, ein Umstand, welcher ebensowohl Brennmaterialersparniß veranlaßt, als auch
ihrer weiteren Zersetzung durch die heißen Kesselwände und sonach der Bildung leicht
explodirbarer Oele entgegentritt. Diese findet vornehmlich dann statt, wenn die
leichteren Dämpfe, wie es bei der gewöhnlichen Destillation der Fall ist,
hinlänglich Zeit haben, sich mit den nachdringenden, schwereren zu vermischen und
nicht wie hier mit der Luft fortgetragen werden. Auch gewährt die Anwendung von Luft
eine bedeutende Zeitersparniß.
Figur 18
stellt einen in Wirklichkeit bestehenden Apparat im senkrechten Längendurchschnitt
dar.
A Luftpumpe, B Dampfkessel,
C Kühlfaß mit Schlange, D Drosselventil, F Ofen zur Dampfüberhitzung;
T ist ein Thermometer zum Ablesen der Temperatur der
in die Blase gepumpten Luft und T' ein solches zur
Temperaturbestimmung der Blasenfüllung.
R ist eine rotirende Dampfmaschine; S ist die aus Kesselblech gefertigte Blase mit Füllung
bis S'; S'' ist ein
Dampfmantel.
V ist ein Dampfgefäß mit der Spirale a² zum Vorwärmen der durch dieselbe nach a³ strömenden Luft. V² ist ein Behälter, welcher eine Auflösung gewisser (mir von dem
Erfinder nicht näher bezeichneter) Chemikalien enthält. a⁴ ist eine daselbst hineintauchende Röhre, welche die Verlängerung
von a³ bildet; a⁵ ist ein in den Kesselinhalt hineintauchendes und a⁶ ein über das Niveau desselben hervorragendes
Rohr. V³ und V⁴ sind Hähne zur Dampfregulirung, und x¹ bis x⁶ (mit Ausnahme von x⁴) Hähne zur Luftregulirung.
Der Betrieb dieses Apparates ist im Wesentlichen der folgende:
Sobald der Dampf einen Druck von 25 bis 30 Pfd. per
Quadratzoll erreicht hat, wird der Hahn V³
geöffnet. Der Dampf tritt durch den Ueberhitzer in den durch die Wand der Blase S und den dieselbe umgebenden Mantel gebildeten Raum,
dort seine Wärme an die zu destillirende Flüssigkeit mittheilend. Zeigt das
Thermometer T' dann 38° Cels. an, so wird die
Pumpe A in Thätigkeit gesetzt. Zu dem Ende wird der Hahn
V⁴ der vom Dampfgefäße V aufsteigenden Röhre geöffnet, jedoch nur so weit, um ungefähr 50
Kolbenhübe per Minute zu erzeugen. Gleichzeitig werden
die Hähne x¹ und x⁶ geöffnet; x² und x³ bleiben indessen geschlossen. Nun muß die
Temperatur rasch erhöht werden; indessen muß dafür gesorgt werden, daß die in die
Blase gepumpte Luft mindestens die Wärme des Oeles habe; sie darf auch um 14 bis
16° C. heißer seyn.
Ungefähr drei Stunden nach dem Beginne der Destillation wird die übergehende
Flüssigkeit circa 50° Baumé anzeigen; die
Temperatur des Oeles ist dann 149° Cels. In diesem Zeitpunkte soll nach dem
Erfinder gern die Bildung ammoniakalischer Gase stattfinden und diese verhütet
werden können, indem man die Luft durch eine Auflösung von in den Behälter V² einzuführender Chemikalien streichen läßt (!).
Es wird dann der Hahn x¹ geschlossen, x² und x³ aber
geöffnet. Von hier an wird die Temperatur sehr allmählich gesteigert. Am Ende der
Operation findet der Erfinder es vortheilhaft, um die sonst regelmäßig eintretende
Bräunung des Destillats zu verhüten, einen Strom von Kohlensäuregas in das Petroleum
streichen zu lassen.
Die beliebtesten Kerosinöle sind diejenigen, welche ähnlich den Kohlenöldestillaten
einen gewissen bläulichen Schimmer zeigen; wie dieser erzeugt wird, ist vielfach
noch Geheimniß. Dasselbe besteht einfach darin, daß man eine geringe Menge Salmiak
in die Destillirblase gibt; über die nähere Wirkungsweise dieses Salzes während der
Destillation fehlt uns aber jede Erklärung.
Tafeln