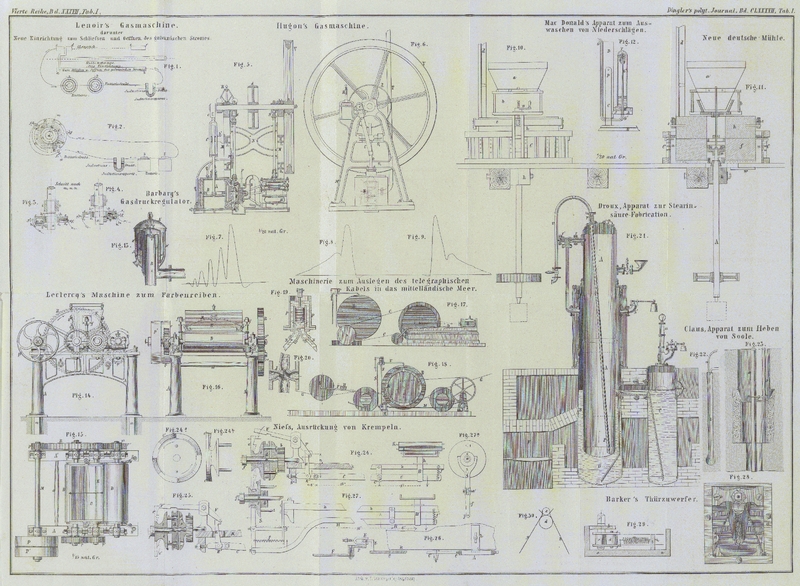| Titel: | Apparat zur Stearinsäure-Fabrication, construirt von Léon Droux, Ingenieur in Paris. |
| Fundstelle: | Band 187, Jahrgang 1868, Nr. XVII., S. 77 |
| Download: | XML |
XVII.
Apparat zur Stearinsäure-Fabrication,
construirt von Léon
Droux, Ingenieur in Paris.
Aus Engineering, Mai 1867, S. 526.
Mit einer Abbildung auf Tab. I.
Droux, Apparat zur Stearinsäure-Fabrication.
Bei der Stearinsäure-Fabrication werden jetzt drei verschiedene Methoden
befolgt, nämlich:
1) die Verseifung der Fettkörper mit 13 bis 14 Proc. Kalk, bei welcher sich in Wasser
unlösliche Seifen – stearinsaurer, oleinsaurer und margarinsaurer Kalk
– bilden, während das frei gewordene Glycerin im Wasser sich löst;
2) die Behandlung der Rohfette mit Schwefelsäure und darnach folgende Destillation.
Die neutralen Pflanzen- und Thierfette werden durch concentrirte
Schwefelsäure verseift; letztere verbindet sich mit dem Glycerin; dieses bleibt in
verkohltem Zustande in den sauren Fetten suspendirt und macht deßhalb eine zweite
Operation, die Destillation, erforderlich. Die
Schwefelsäure-Glycerin-Verbindung bleibt als theerige Masse im
Destillirgefäße zurück, während die sauren Fette in den Condensationsapparat
übergehen;
3) die Zersetzung der Fettkörper durch gleichzeitige Einwirkung von Wasser, höherer
Temperatur und Druck. Dieses Verfahren wird als
„Wasserverseifung“ bezeichnet.
Bei Anwendung des erstgedachten Verfahrens erhält man die besten Producte; dieselben
sind weiß, geruchlos, trocken anzufühlen; indessen ist die Methode, in Folge des zur
Zersetzung der Kalkseife und zu ihrer Umwandlung in freie Fettsäuren und
schwefelsauren Kalk erforderlichen Aufwandes an Schwefelsäure, kostspielig. –
Das zweite Verfahren gibt gleichfalls weiße Producte; doch sind dieselben weicher
und schmelzen bei niedrigerer Temperatur; überdieß entwickeln die nach dieser
Methode fabricirten Kerzen beim Brennen einen empyreumatischen, nicht angenehmen
Geruch. Indessen ist das Verfahren billig, da man bei Anwendung desselben eine große
Menge Stearin erhält, wogegen freilich das gewonnene saure Oel von geringerem Werthe
ist, als das durch die Kalk-Verseifungsmethode erhaltene. – Der dritte
Proceß vereinigt die Vortheile des ersten und zweiten Verfahrens, ohne die
Nachtheile des letzteren; er ist billig, liefert ein weißes Stearin und gleichzeitig
ein saures Oel von guter Qualität; doch ist seine Anwendung mit einer Schwierigkeit
verbunden, welche darin besteht, daß zur Behandlung der Fettkörper ein Gefäß
erforderlich ist, welches hinlängliche Festigkeit besitzt um einem inneren Drucke
von etwa 210 Pfund per Quadratzoll zuverlässig
widerstehen zu können.
Derartige Gefäße zur Aufnahme der unter einem so hohen Drucke zu behandelnden
Fettkörper können aus Eisenblech nicht construirt werden, da dieses von den
Fettsäuren sehr bald angegriffen wird; deßhalb wurden sie aus Kupfer angefertigt,
welches wiederum einem stärkeren Drucke nicht so gut Widerstand zu leisten vermag
als Eisen, namentlich bei der hohen Temperatur, welche zum Gelingen des Processes
erforderlich ist. Aus diesem Grunde muß ein zu dem in Rede stehenden Zwecke
bestimmtes Gefäß aus Kupfer bedeutende Wandstärke besitzen, wodurch es einerseits
vertheuert, während es andererseits in Folge dieser größeren Wandstärke durch die
unmittelbare Einwirkung des freien Feuers leichter beschädigt wird. Zur Beseitigung
dieser Uebelstände hat der Ingenieur Léon Droux
sich einen von ihm erfundenen Apparat patentiren lassen, welcher bereits in mehreren
großen Fabriken eingeführt wurde und von dem ein Exemplar erster Größe in Classe 51 der
französischen Abtheilung im Industriepalaste zu Paris ausgestellt war.
Dieser in Fig.
21 abgebildete Apparat besteht in einem großen cylindrischen Kupfergefäße
A, A, von 2 Fuß Durchmesser, in welches die zu
verseifenden Fette durch den mit Absperrhahn a
versehenen Trichter eingefüllt werden. Dieser Kupfercylinder hat 3/5 Zoll
Wandstärke, und vermag ungefährdet einen inneren Druck von 15 Kilogr. per Quadratcentimeter oder etwa 213 Pfd. (engl.) per Quadratzoll zu ertragen; auf den größeren Theil
seiner Länge wird er von einem äußeren, aus Eisenblech angefertigten Cylinder B, B umgeben, welcher 0,63 Zoll Wandstärke hat und einem
gleichen Drucke, wie der Kupfercylinder, zu widerstehen im Stande ist. Der untere
Theil dieses eisernen Cylinders, welcher Wasser enthält, steht in einem Ofen, so daß
er als Wasserbad für das Kupfergefäß und gleichzeitig als Dampfkessel zur Erzeugung
des für die Zersetzung der Fette nöthigen Dampfes dient. Bei der Gleichheit des im
Kupfer- und im Eisengefäße stattfindenden Druckes ist letzteres einer
Spannung und dadurch bedingten Verletzung nicht unterworfen; dagegen ist dieß bei
dem oberen Theile des Kupfercylinders der Fall und unserer Ansicht nach würde Hr.
Droux seinem Apparate eine nicht unwichtige
Verbesserung hinzufügen, wenn er auch diesen oberen Theil des inneren Gefäßes mit
dem eisernen Mantel umgeben wollte, was leicht ausführbar wäre.
Der im Cylinder B, B erzeugte Dampf wird durch das
Röhrensystem r, v, p in den inneren Cylinder geleitet
und tritt durch das Ende p dieses Systemes, auf dem
Boden desselben ein.
Nachdem das Sieden sechs Stunden ununterbrochen angedauert hat und während dieser
Zeit die Zersetzung der Fette durch die gleichzeitige Einwirkung des Wassers, der
Hitze und des Druckes vollständig vor sich gegangen ist, wird der Hahn r' geschlossen, wodurch der Dampf vom Boden des
Kupfergefäßes abgesperrt wird, und der Hahn r geöffnet,
so daß Dampf auf die Oberfläche der der Behandlung unterworfenen Fettsubstanzen
strömt. Beide Hähne sind durch Zahnradsegmente und Trieb in der Weise mit einander
verbunden, daß der eine von ihnen sich stets schließt, sobald der andere geöffnet
ist, somit also die Communication zwischen dem Inneren des Kupfercylinders und dem
äußeren Gefäße oder Mantel niemals vollständig unterbrochen ist. Zur Entleerung des
Kupfergefäßes A braucht man nur, wenn her Hahn r' geschlossen und r
geöffnet ist, den Hahn v' zu öffnen, worauf die
Flüssigkeiten in Folge des auf ihre Oberfläche wirkenden Dampfdruckes durch das Rohr
p, v ausgetrieben werden.
Der kleinere, gleichfalls aus Eisen angefertigte Cylinder C, welcher mit dem Cylinder B in Verbindung
steht, wird ebenfalls mit Wasser gefüllt erhalten und dient zur Aufnahme des
Speisewassers, als Vorwärmer. Er ist mit einem Schwimmer zur Angabe des
Wasserstandes, sowie mit einem Sicherheitsventile S
versehen; ein zweites Sicherheitsventil S' ist an dem
größeren Cylinder B angebracht. Diese Ventile sowohl,
als der Wasserstandszeiger, sind nur der Einwirkung des Dampfes unterworfen und
kommen mit den Fetten gar nicht in Berührung.
Tafeln