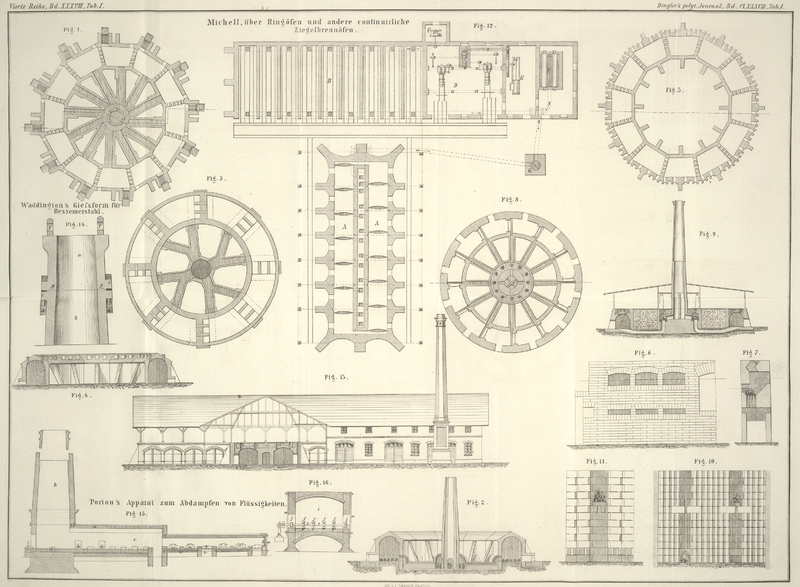| Titel: | Ueber Ringöfen und andere continuirliche Ziegelbrennöfen neuerer Construction; von F. Michell, technischem Director der Actien-Biegelei München. |
| Autor: | F. Michell |
| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. XIV., S. 30 |
| Download: | XML |
XIV.
Ueber Ringöfen und andere continuirliche
Ziegelbrennöfen neuerer Construction; von F. Michell, technischem Director der Actien-Biegelei
München.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Michell, über Ringöfen und andere continuirliche
Ziegelbrennöfen.
Seit etwa dreißig Jahren hat die Anwendung des continuirlichen Heizungsprincipes bei
der Construction von Ziegelöfen immer steigende Aufnahme gefunden, so daß heutzutage
der intelligente Theil der Ziegeleibesitzer überall gut construirte Oefen mit
ununterbrochenem Betriebe für eine vortheilhafte Fabrication unentbehrlich hält. Wie
in allen Industriezweigen, hat auch in diesem die Concurrenz fast aller Orten so
sehr überhand genommen und die Preise der Producte so sehr herabgedrückt, daß nur
der Ziegeleibesitzer bestehen kann, welcher sich die enorme Brennstoffersparniß
eines continuirlichen Ofens zu Nutzen macht. Immer unabweisbarer wird das Bedürfniß
solcher Oefen, je mehr die Brennmaterialien stetig im Preise steigen und leider muß
dieß mit Bestimmtheit angenommen werden.
Unter den continuirlichen Oefen haben bis heute die Ringöfen die größte Verbreitung
gefunden; dieß ist das Verdienst des Hrn. Baumeisters Fr. Hoffmann in Berlin, welcher durch rastlosen Eifer es dahin gebracht hat,
daß die continuirlichen Oefen dieser Construction trotz ihrer hohen Anlagekosten und
sonstigen Mängel (auf die ich später zu sprechen komme) in allen civilisirten
Ländern der Erde mehr oder weniger Aufnahme gefunden haben.
Bei der großen Bedeutung der continuirlichen Oefen für die Ziegel- und andere
Industrien, und da ich annehmen darf, daß die Entstehung und Entwickelungsgeschichte
derselben manchen Lesern dieses Journals in ihrem ganzen Zusammenhang nicht bekannt
und daher von Interesse seyn dürfte, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, so weit es
authentische Quellen und Erfahrungen mir ermöglichten, im Folgenden einen Beitrag
dazu zu liefern und weiters eine neue, meines Wissens noch nicht veröffentlichte
Constructionsart continuirlicher Oefen, mit künstlicher Trocknung verbunden, zu
beschreiben.
Im Jahre 1841 hat sich Joseph Gibbs, Civilingenieur aus
Kennington, in England einen Ringofen patentiren lassen, welchen Fig. 1 im Grundriß und
Fig. 2 im
Querschnitt darstellt. Dieser Ringofen (circular kiln)
ist mittelst durchbrochener Zwischenmauern in 12 Unterabtheilungen getheilt. Der
Schornstein communicirt mit der Heizung im Ofen mittelst eines beide verbindenden
ringförmigen Rauchsammelcanales, in welchen absperrbare Rauchcanäle einmünden.
Fig. 3 zeigt im
Grundriß und Fig.
4 im Querschnitt eine Modification dieses Ofens; hierbei läßt Gibbs die Rauchgase durch senkrechte Röhren im
Ofengewölbe abziehen, wobei Schornstein, Rauchsammler und Rauchcanäle umgangen
sind.
Einen anderen Ringofen, erbaut zu Villeneuvele-Roi in Frankreich, finden wir
in Förster's Bauzeitung (Wien 1857) veröffentlicht. Fig. 5 stellt
den Grundriß desselben dar, Fig. 6 u. 7 gemauerte Schürschächte
im Brennraum.
Dieser Ringofen unterscheidet sich wesentlich von den vorstehenden, indem die
Verbrennung mit heißer Luft erfolgt, während Gibbs sich
noch der gewöhnlichen mit kalter Luft gespeisten Rostheizung bediente. Das
Brennmaterial wird hier von oben in gemauerte Schürschächte eingeworfen und erhält
zur Verbrennung die durch die zurückliegenden frisch ausgebrannten Abtheilungen
geströmte und dadurch hoch erhitzte atmosphärische Luft. Der Betrieb dieses Ofens
findet ganz in derselben Weise statt wie bei dem besprochenen Gibbs'schen Ofen (Fig. 1 u. 2) und dem nachfolgenden
sogen. Hoffmann'schen (beschrieben vom Erfinder im
polytechn. Journal, 1860, Bd. CLVIII S. 183).
Ich gehe nun zu der bekanntesten Modification der Ringöfen, zu dem Ofen von Hoffmann und Licht in Berlin
über, welcher in Fig. 8 im Grundriß und in Fig. 9 im Querschnitt
abgebildet ist. Dieser Ofen stellt eine Vereinigung der Gibbs'schen Construction mit der Verbrennungsmethode des Ofens in
Villeneuve dar; wir finden hier übereinstimmend mit Gibbs' Construction (man vergl. Fig. 1) einen in
Unterabtheilungen eingetheilten ringförmigen Brennraum, ferner einen ringförmigen
Rauchsammler mit Einströmungsöffnungen zum Kamin, einen aus jeder Unterabtheilung
nach dem Rauchsammler führenden absperrbaren Rauchcanal, und endlich senkrechte
Röhren im Ofengewölbe, die aber hier nicht als Rauch-, sondern als Heizröhren
dienen.
Die Heizmethode ist, wie gesagt, der französischen Anordnung entsprechend, das
Brennmaterial wird ebenfalls von oben in Schürschächte eingeworfen und wie dort
erfolgt die Verbrennung mit erhitzter Luft. Die Schürschächte des französischen
Ofens sind stabil (aufgemauert), Fig. 6 und 7; beim Hoffmann'schen Ofen werden sie aus den zu brennenden
Steinen gebildet, siehe Fig. 10 u. 11. In der
Praxis hat letztere Anordnung, gegenüber der französischen, unter Umständen ihre
Vorzüge; beim Brennen von gewöhnlichen Backsteinen nämlich, welche man der directen Berührung mit
dem Brennmaterial aussetzen darf, kann der Raum, den gemauerte Schürschächte
wegnehmen würden, dadurch mitbenutzt werden, daß man die Schürschächte jedesmal aus
den zu brennenden Steinen bildet.
Vom theoretischen Standpunkt hat die erwähnte Abweichung am Hoffmann'schen Ofen keine Bedeutung, denn principiell ist es gleichgültig
ob die Schürschächte aufgemauert sind und stehen bleiben, oder aus losen Steinen
aufgesetzt und beim jedesmaligen Leeren des Ofens entfernt werden. Im Princip ändert
das, wie gesagt, nichts, da im einen wie im anderen Falle das Feuer ungehindert von
einer Abtheilung in die andere strömt, das Einwerfen des Brennmaterials in die
Schürschächte von oben geschieht, die Verbrennung mit (auf gleiche Weise) erhitzter
Luft erfolgt.
Es erübrigt mir noch, auf ein Verschlußmittel am Hoffmann'schen Ofen aufmerksam zu machen, welches wir an den früheren Ringöfen
nicht finden: Hr. Hoffmann bedient sich nämlich zum
Abschließen der Canalausmündungen im Rauchsammler und der Beschickungs- oder
Heizröhren im Gewölbe, eiserner in Sand gebetteter Glocken statt Schieber oder
Platten; diese Anordnung ist äußerst zweckmäßig, wenn auch nicht von Hrn. Hoffmann erfunden. Die Anwendung von Sandglocken finden
wir bei vielen Oefen als Verschlußmittel schon früher, z. B. bei den Siemens'schen, bei dem von Dr. Zerrenner beschriebenen Glasofen in Tscheitsch
(Wien 1856) und bei anderen.
Aus den vorstehenden geschichtlichen Mittheilungen geht hervor, daß Hr. Hoffmann nicht der Erfinder der Ringöfen und des
denselben zu Grunde liegenden Heizungsprincips ist; wohl aber gebührt ihm das schon
Eingangs hervorgehobene Verdienst: die continuirlichen Ziegelöfen durch seine
Ringöfen überall bekannt gemacht und eingeführt zu haben.
Nach meiner Ansicht haften den Ringöfen hauptsächlich folgende Mängel an:
1) Daß es schwer hält, gleichmäßig gebrannte Waare zu erzielen,
weil der Zug, also die Hitze, stets nach dem inneren Zirkel drängt, um naturgemäß
auf dem kürzesten Wege zum Abzuge zu gelangen. In neuerer Zeit schlägt Hr. Hoffmann mitunter vor, die Oefen nicht kreisrund sondern
oval zu bauen, wodurch einigermaßen diesem Uebelstande abgeholfen wird.
2) Die enormen Anlagekosten machen es unbemittelten Zieglern
vorweg unmöglich sich solche Oefen anzuschaffen, während auch der bemittelte
Ziegeleibesitzer sein Anlagecapital damit in einer Weise erhöht, daß Zinsen und
Amortisation den durch das continuirliche System am Brennmaterial erzielten Gewinn
bedenklich schmälern.
Nachdem ich nun meine Erfahrungen und Ansichten über die Ringöfen dem Urtheil der
geehrten Leser hiermit übergeben habe, will ich noch eine kurze Beschreibung der Einrichtung der unter meiner technischen Leitung stehenden
Ziegelfabrik folgen lassen.
Fig. 12 stellt
den Grundriß eines Complexes dar, deren wir drei besitzen; jeder Complex ist auf
eine jährliche Production von drei Millionen Backsteinen berechnet. Sie wurden im
Laufe des Jahres 1864 nach dem System der Techniker Bührer und Hamel (in München) erbaut und
bestehen aus continuirlichen Parallelöfen mit combinirter
Trockenanlage und Ventilatorbetrieb.
In Fig. 12 ist
A der Grundriß des continuirlichen Parallelofens.
Dieser Ofen besteht aus zwei parallel laufenden Brennräumen, die an ihren Endpunkten
durch je einen kleinen Canal oder Schlitz mit einander in Verbinduug gebracht werden
können, durch welche Anordnung ein continuirlicher Betrieb stattfindet. Zwischen den
beiden Brennräumen liegt der Hauptabzugscanal für die Rauchgase, welche von hier aus
durch einen Canal in die Trockenanstalt geführt werden.
Die Anlage dieser Oefen kommt viel billiger zu stehen als die des Ringofens, denn das
ausschließlich gerade Mauerwerk wird leicht und rasch ausgeführt, die langen
Abzugscanäle zum Rauchsammler fallen hier weg, ebenso das Mauerwerk des beim
Ringofen besonders ausgeführten Rauchsammelcanales, denn hier entsteht der letztere
durch die Seitenmauern der Ofenräume von selbst.
B ist der Grundriß der combinirten Trockenanlage.
Dieselbe besteht aus einer entsprechenden Anzahl von Kammern, in welchen sämmtliche
vom Ofen abziehende Rauchgase zum Trocknen von eben so viel Steinen verwendet werden
als die Beschickung des Ofens erfordert.
C ist ein exhaustirender Ventilator als Betriebsmittel
für den Ofen und die Trockenanstalt zusammen; mittelst dieser Anordnung wird die
Temperatur der Rauchgase, welche bei jeder bisherigen Einrichtung mit circa 300° C. durch den Schornstein abzogen, auf
20 und 25° C. ausgenutzt.
D ist der Ziegelmaschinen-Raum.
E ist der Dampfmaschinen-Raum. F ist der Dampfkessel; die Abwärme der
Dampfkesselheizung wird ebenfalls in die Trockenanstalt geführt und dort
ausgenutzt.
G ist ein Reserve-Schornstein, um bei Reparaturen
an der Dampfmaschine oder dem Ventilator den Ofen allein betreiben zu können.
Fig. 13 ist
ein Ofenquerschnitt mit dahinterliegender Längenansicht des Trocken- und
Fabrications-Gebäudes.
Der Ziegeleibetrieb ist mit dieser Einrichtung in die Reihe der regelmäßigen
Fabricationen getreten; während derselbe nach bisheriger Weise in den meisten
Klimaten auf wenige Sommermonate beschränkt ist, sind bei dieser Methode alle
Witterungseinflüsse beseitigt.
Nicht nur nach meiner Erfahrung, sondern auch nach dem Urtheile hervorragender Männer
der Wissenschaft und Praxis ist diese Einrichtung das Vollendetste was die Technik
auf dem besprochenen Gebiete bis auf den heutigen Tag geleistet hat; ich fühle mich
verpflichtet, auf die Leistungen der Herren Bührer und
Hamel bei der Ausführung dieser Construction
aufmerksam zu machen, und erkläre mich mit Vergnügen bereit den Interessenten
gewünschte Nachweise zu liefern.
Tafeln