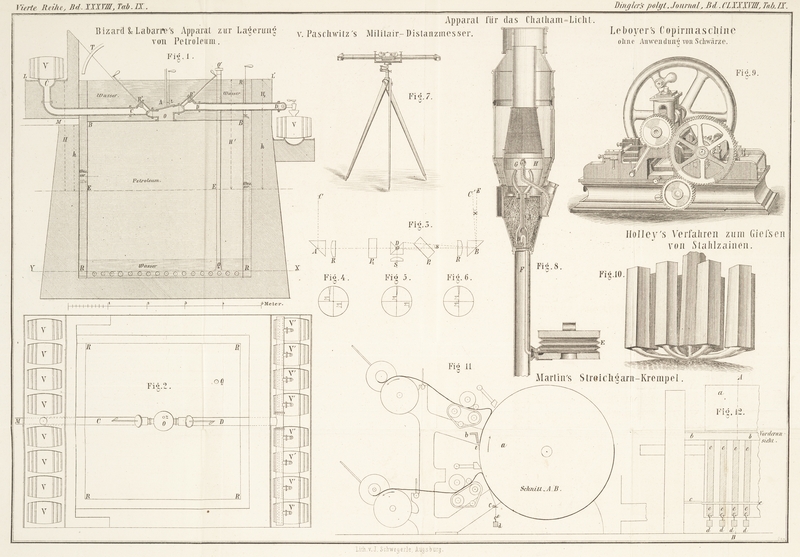| Titel: | Das Chatham-Licht für Nacht-Signale. |
| Fundstelle: | Band 188, Jahrgang 1868, Nr. CIV., S. 436 |
| Download: | XML |
CIV.
Das Chatham-Licht für Nacht-Signale.
Im Auszuge aus Engineering, Mai 1868, S.
454.
Mit einer Abbildung auf Tab. IX.
Das Chatham-Licht für Nachtsignale.
Mit dem Ausdrucke Chatham-Licht wird in unserer
Quelle eine nach einer recht einfachen Methode durch ebenso einfache Mittel
verstärkte Lichtquelle bezeichnet, welche in der letzten Zeit in Abessinien für
telegraphische oder Signalisirungszwecke mit Nutzen angewendet worden ist. Die
hierfür benutzte Lampe mit Zugehör ist in Fig. 8 in 1/5 ihrer
wirklichen Größe dargestellt. Zum Signalisiren für diese und ähnliche Zwecke werden
mit großem Vortheile die (in diesem Journale Bd.
CLXXXVII S. 364 beschriebenen)
Signalisirungs-Apparate von Colomb in Anwendung
gebracht. Soll die Signalisirung auf sehr große Entfernungen von mehr als 20
Seemeilen sich erstrecken, so ist eine Lichtstärke nothwendig, wie sie nur vom
elektrischen Lichte dargeboten werden kann. Bei Entfernungen von etwa 6 bis zu 20
Seemeilen dürfte das Kalk- oder auch das Magnesium-Licht nothwendig
und ausreichend seyn, da bei nebeliger Atmosphäre nur Lichtquellen von großem Glänze
für derartige Zwecke erklecklich seyn können. Da aber die zur Herstellung solcher
Lichtquellen nöthigen Apparate nicht transportabel genug find, so muß man sich in
solchen Fällen, wo die Transportabilität der Apparate als eine Hauptbedingung
anzusehen ist, mit Lichtquellen von geringerer Stärke, also mit Oellampen u. dgl.
begnügen. Das in Rede stehende Verfahren zeigt nun, wie man selbst bei Anwendung
einer Flamme von geringerer Helligkeit den Lichtglanz momentan oder durch längere
Zeit bis zu einem bedeutenden Grade zu erhöhen im Stande ist. Das Princip, auf
welchem dieses Verfahren beruht, besteht einfach darin, daß man in die Flamme unter
Anwendung einer geeigneten Vorrichtung beständig pulverisirte und überhaupt auf das
Feinste zertheilte Substanzen hineinbläst, welche kohlenstoffreich sind, oder welche
bei ihrer Zerlegung kohlenwasserstoffhaltige Verbindungen entwickeln. Daß hierfür auch Magnesiumpulver
u. dgl. und überhaupt solche Metallpulver verwendet werden können, welche selbst in
einer gewöhnlichen Flamme den höchsten Glühegrad annehmen, versteht sich von
selbst.
In Fig. 8 sehen
wir vor Allem am oberen Theile derselben eine Lampe mit Abzugskamin nebst den dazu
gehörigen Vorrichtungen, wie sie zur Colomb'schen Lampe
für Nachtsignale gehören. Der Brenner ist hierbei bloß ein Docht, der in ein
Spiritusgefäß einmündet, nämlich eine kleine Weingeistflamme; letztere ist zum
Schutze der Umhüllungsgläser etc. mit einem Drahtnetze umgeben. Unterhalb der Lampe
befindet sich ein Gefäß A, in welches das zum Einblasen
in die Flamme dienende Pulver gebracht wird; das Gefäß ist bei B durch einen Deckel verschlossen und durch dieses obere
Ende geht ein Rohr, welches nach unten bei C erweitert
ist und hier mit dem Pulvergefäße in Verbindung steht, also an seinem unteren Ende
offen ist. Die aus dem Pulvergefäße austretende Röhre des Gefäßes C verzweigt sich in zwei Röhren, deren offene Enden G und H in der Nähe des
unteren Endes der Flamme ausmünden. Das Pulvergefäß A
selbst ist auf die Säule F festgeschraubt, und durch
letztere geht das Ausströmungsrohr F, welches in dem
Reservoir C mit seinem heberförmigen, nach abwärts
gebogenen Ende D ausmündet, während das untere Ende des
Rohres F an der Düse des doppelten Blasbalges E luftdicht angebracht ist. Wird der Blasbalg in
Thätigkeit versetzt, so wird die durch das Rohr F
getriebene und bei D einströmende Luft nach Willtür mit
größerer oder kleinerer Geschwindigkeit durch das Rohr C
hinausgeblasen werden können. Hierbei wird aber nothwendig der Pulverstaub in dem
Gefäße A mit einer gewissen Heftigkeit mitgeführt, und
derselbe muß daher, bei G und H austretend, in die Flamme gelangen. Da einerseits das Pulver in der
Flamme zum heftigen Glühen kommt und andererseits unter Anwendung des Gebläses der
zum vollständigen Verbrennen und starken Leuchten nöthige Luftzug leicht unterhalten
werden kann, so wird man auf diese Weise ein für viele Zwecke hinreichend starkes
Licht zu erzeugen im Stande seyn. Da man durch Veränderung des Druckes der Luft
mittelst des Blasbalges die Lichtintensität bald verstärken, bald schwächen kann, so
ist man im Stande, unter Anwendung dieses Mittels sogar die Zahl der Signale des Colomb'schen Apparates zu vergrößern. Bei kurzen
Strecken, auf welche signalisirt werden soll, und heiterem Himmel reicht es aus,
wenn das Gefäß A mit Kohlenstaub, nämlich mit
pulverisirter Kohle in lockerer Weise gefüllt wird. Bei Entfernungen von 3 bis zu 6
engl. Meilen wird pulverisirtes Harz verwendet, und soll die Tragweite des
Signallichtes noch
größer werden, so verwendet man zur lockeren Unfüllung des Gefäßes A ein Gemenge von pulverisirtem Harze und zerstoßenem
Magnesium.
Tafeln