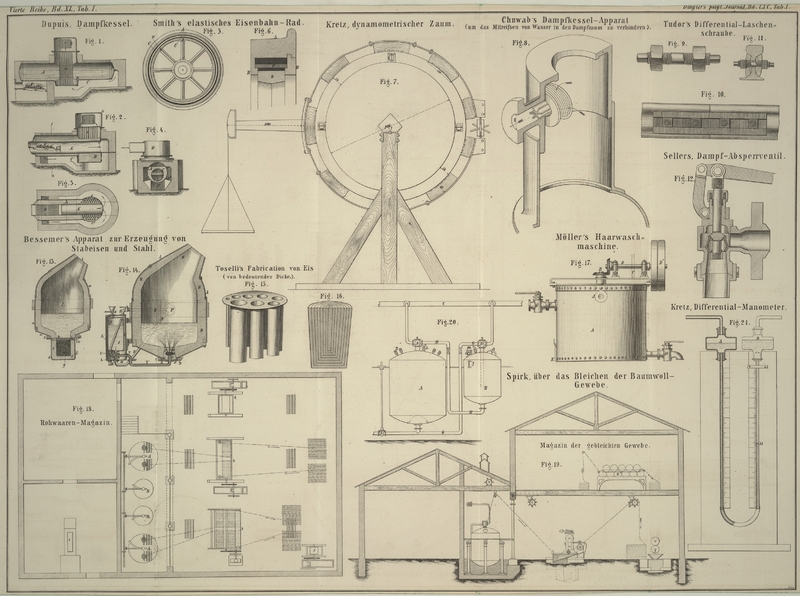| Titel: | Mittheilungen über das neueste, in den meisten Kattundruckereien schon übliche Bleichverfahren für Baumwollgewebe; von Dr. Anton Spirk. |
| Autor: | Anton Spirk |
| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XXIII., S. 66 |
| Download: | XML |
XXIII.
Mittheilungen über das neueste, in den meisten
Kattundruckereien schon übliche Bleichverfahren für Baumwollgewebe; von Dr. Anton Spirk.
Mit Abbildungen auf Tab.
I.
Spirk, über das Bleichen der Baumwollgewebe.
Die Materialangaben im Folgenden beziehen sich auf eine Bleichpost von 700 Stück à 50 Meter Länge. Behufs eines vollständigen Bleichens
werden die Baumwollgewebe folgenden Operationen unterzogen:
1) Werden die rohen Baumwollgewebe zusammengenäht;
2) sengt man dieselben auf der Maschine Nr. 1 (Fig. 18);
3) wäscht man sie auf der Waschmaschine Nr. 2 (Fig. 18),
4) werden die Stücke im Hochdruckapparate A (Fig. 18) einem
fünfstündigen Kochen in Kalkmilch unterworfen. Man verwendet für die erwähnte
Bleichpost 70–80 Kilogrm. Aetzkalk; die mit demselben dargestellte Kalkmilch
wird im Siedekessel B (Fig. 18) zum Kochen
gebracht, um dann auf die im Siedekessel A befindliche
Waare getrieben zu werden.
5) Nach dem Kochen in Kalkmilch und bewerkstelligter Abkühlung werden die Stücke mit
der Waschmaschine Nr. 2 (Fig. 18) in Verbindung
gesetzt, welche dieselben aus dem Siedekessel herauszieht und wäscht.
6) Die Stücke werden nun durch 2 Grad Baumé starke Salzsäure auf der
Walzenwaschmaschine (clapot) Nr. 4 (Fig. 18) gezogen und dann
während vier Stunden aufgehäuft liegen gelassen. Ein Stück von 50 Meter Länge bleibt
ungefähr 20 Minuten in der Waschmaschine. Die Säure in der Maschine wird mittelst
eines Rohres mit dem Salzsäure-Reservoir in Verbindung gesetzt, um sie in der
verlangten Menge und Stärke zu erhalten.
(Die Behandlung der Waare mit Salzsäure wird in einigen Fabriken noch in runden
Holzbottichen vorgenommen. Der Holzbottich wird mit der Waare angefüllt und hierauf
die Säure aus einem unter Druck stehenden Reservoir mittelst einer Pumpvorrichtung
auf die Waare gebracht. Nach Verlauf von 1 bis 1½ Stunden wird die Säure
abgelassen, um abermals auf die Stücke gepumpt zu werden. Diese Operation wird
während eines Zeitraumes von acht Stunden fünf- bis sechsmal wiederholt. Das
Salzsäurebad wird für jede nachfolgende Bleichpost entsprechend aufgebessert.)
7) Man wäscht die Stücke nun zweimal auf der Maschine Nr. 3 (Fig. 18); es ist von
großem Belange, daß sie gehörig gewaschen werden, bevor man sie der folgenden
Operation unterzieht, damit sie frei von aller Säure sind.
8) Die Stücke werden nun fünf Stunden lang im Hochdruckapparat A1 (Fig. 18) mit einer
Harzseifenlösung ausgekocht. (Die Behandlungsweise dieses Apparates ist unten
angegeben.) Die Harzseifenlösung wird durch mehrstündiges Kochen von 110 Kilogr.
calcinirter Soda und 70 Kilogr. Colophonium mit der erforderlichen Wassermenge
dargestellt.
9) Nachdem die Harzseife abgelassen wurde, werden die Stücke in demselben Kessel,
ohne erst gewaschen worden zu seyn, mit einer Lösung von 200 Kilogr. krystallisirter
Soda vier Stunden lang ausgekocht, und alsdann
10) auf der Maschine Nr. 3 (Fig. 18) gewaschen,
wornach sie
11) auf der Walzenwaschmaschine (clapot) Nr. 4 (Fig. 18) durch
eine Chlorkalk-Auflösung von 1002,5 specif. Gewichte gezogen werden und dann
fünf Stunden lang aufgehäuft liegen bleiben.
12) Die Stücke werden nun auf der Maschine Nr. 3 (Fig. 18) gewaschen und
dann
13) auf der Walzenwaschmaschine (clapot) Nr. 4 durch ein
2° Baumé starkes Salzsäurebad genommen, und hierauf fünf Stunden aufgehäuft
liegen gelassen. (Das Behandeln der Waare mit der Chlorkalklösung und der Salzsäure
kann auch auf die unter 6) angegebene Weise vorgenommen werden, wobei
selbstverständlich sowohl das Chlorkalk- als das Salzsäurebad für jede nachfolgende
Bleichpost entsprechend aufgebessert werden muß.)
14) Werden die Stücke auf der Maschine Nr. 3 gewaschen und dann
15) mittelst der Quetsch- oder Wringemaschine Nr. 5 (Fig. 18 und 19)
ausgepreßt, um
16) auf der Dampf-Trockenmaschine Nr. 6 (Fig. 19) abgetrocknet zu
werden.
Verfahren beim Kochen der Waare im
Hochdruckapparate (Fig. 20.)
Nachdem man den Boden des großen Kessels A, fig. 20, mit
Steinen belegt hat, füllt man den Kessel mit den Stücken, indem man beachtet, daß
zwischen den Falten derselben kein leerer Raum bleibt. Je mehr man die Stücke bei
dieser Operation gegen die Seitenwände des Kessels preßt, desto besser und
gleichmäßiger wird das Auskochen vor sich gehen. Nachdem der Kessel gefüllt ist,
bedeckt man die Stücke mit Sackleinwand und beschwert sie mit Gewichten oder
Steinen. Alsdann schließt man das Mannloch R, öffnet den
Auslaßhahn I und läßt mittelst des Hahnes D Dampf einströmen; dieser drückt die Stücke nieder, und
verdrängt die Flüssigkeit sowie die atmosphärische Luft. Nachdem der Dampf bei dem
Hahne I anfängt herauszublasen, läßt man denselben noch
einige Minuten offen und leitet während dieser Zeit die Kalkmilch oder die
Harzseifenlösung in den Kessel B durch den Hahn M, wornach man, um dieselbe zum Sieden zu bringen, durch
den Hahn E Dampf in den Kessel einströmen läßt. Hierauf
schließt man den Hahn D so, daß der Kessel A weder mit dem Dampfrohr C
noch mit dem Rohr H in Verbindung steht. Nach einigen
Minuten, während welcher Zeit sich der Dampfdruck im Kessel A vermindert, schließt man den Hahn I und
öffnet den Hahn D so, daß der Kessel A mit dem Rohre H in
Verbindung kommt. Auf diese Weise treibt der Druck des Dampfes die Flüssigkeit aus
dem Siedekessel B durch das Rohr H auf die im Kessel A befindliche Waare. Wenn
sämmtliche Flüssigkeit, welche sich im Siedekessel B
befand, in den Kessel A getrieben worden ist, was man an
dem Glase J sehen kann, so schließt man den Hahn E, damit derselbe weder mit dem Dampfrohre C noch mit dem Dampfrohre G
in Verbindung stehe. Man läßt nun Dampf in den Kessel A
eintreten und nach einigen Minuten, während welcher Zeit sich der Dampfdruck im
Kessel A steigert, öffnet man den Hahn E, welcher den Siedekessel B
mit dem Rohre G in Verbindung setzt. Auf diese Weise
treibt der Dampf die Flüssigkeit durch die Waare und durch das Rohr G in den Siedekessel B
zurück. Es ist nothwendig, daß man bei dieser Operation den Lufthahn L an dem
Kessel, in welchen man die Flüssigkeit treibt, öffnet; derselbe muß jedoch zur
gehörigen Zeit wieder geschlossen werden, weil sonst Flüssigkeit durch ihn
ausströmen würde. Wenn man am Glase J bemerkt, daß sich
sämmtliche Flüssigkeit im Kessel B befindet, so sperrt
man den Dampf ab und leitet denselben in den Kessel B,
um von Neuem die Flüssigkeit zu erhitzen und in den Kessel A zu treiben. Dieses Verfahren wiederholt man 4–5 Stunden lang, in
welcher Zeit die Stücke hinlänglich ausgekocht sind. Man öffnet hernach den
Ablaßhahn I, und nachdem der Dampf die Flüssigkeit aus
dem Kessel A herausgetrieben hat, läßt man denselben
noch einige Minuten durchblasen, sperrt ihn dann ab und öffnet den Lufthahn L. Sobald der Dampf im Kessel A seine Spannung verloren hat, wird das Mannloch geöffnet, um die Waare
mit kaltem Wasser abkühlen zu können. — Beim Anfüllen des Siedekessels B muß man einigen Raum übrig lassen, damit die
Flüssigkeit Platz zur Ausdehnung hat; der leer zu lassende Theil ist mittelst des an
diesem Kessel befindlichen Indicatorglases leicht zu bestimmen.
Die Einrichtung einer Bleiche nach dem beigegebenen Plane, Fig. 18 und 19, wird von
der bekannten Firma John M. Sumner in Manchester in befriedigendster Weise
besorgt.
Cosmanos, im September 1868.
Tafeln