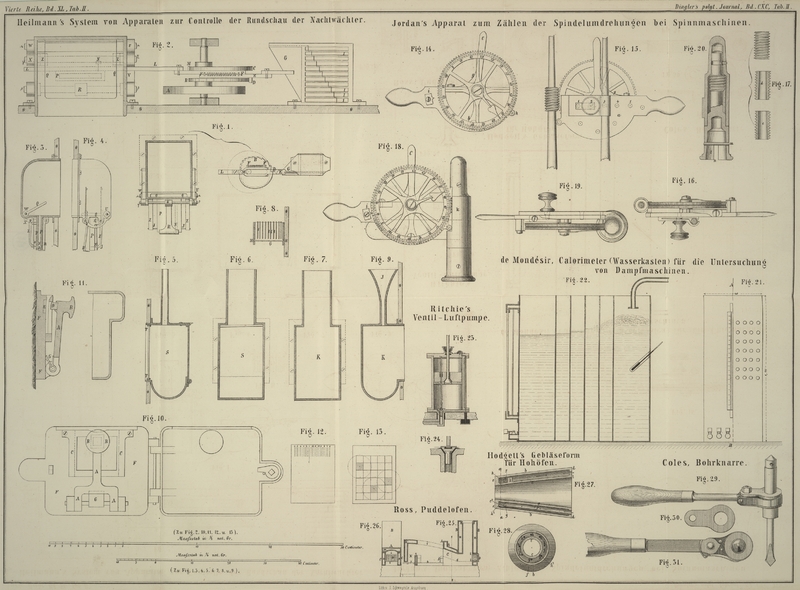| Titel: | Verbesserte Luftpumpe von E. S. Ritchie in Boston, Mass. |
| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. XXVI., S. 83 |
| Download: | XML |
XXVI.
Verbesserte Luftpumpe von E. S. Ritchie in Boston,
Mass.
Aus dem Journal of the Franklin Institute, vol. LXXXVI p. 12; Juli 1868.
Mit Abbildungen auf Tab.
II.
Ritchie's Ventil-Luftpumpe.
Diese Ventil-Luftpumpe unterscheidet sich von den bekannten Constructionen
dieser Art wohl durch die Verbesserung einzelner ihrer Organe, zum größten Theile
aber durch eine exacte Ausstattung der letzteren. Ueber die Einrichtung der von Ritchie construirten Luftpumpe sagt unsere Quelle
Folgendes:
Der Cylinder oder Stiefel hat die gewöhnliche Form; die Kolbenstange kann durch Kurbel, Hebel u.
dgl. in Bewegung versetzt werden. Die Eigenthümlichkeiten der Luftpumpe beziehen
sich auf die Construction des Kolbens und der Ventile, sowie auf die Art, wie
letztere in Thätigkeit versetzt werden. Die Anordnung der wesentlichen Theile des
Apparates kann aus dem Querschnitte Fig. 23 ersehen werden.
— Das untere Ventil ist conisch und wird durch einen dreieckigen Dorn, der
genau in die Oeffnung paßt, an seinem Platze erhalten; die Ventilstange geht durch
den Kolben mittelst einer Stopfbüchse. In dem vergrößerten Querschnitte (Fig. 24) ist
gezeigt, wie die Verbindung des Ventiles mit der Stange angeordnet, so daß eine
seitliche Bewegung der letzteren gestattet ist, wenn eine geringe Veränderung beim
Anschließen des Kolbens oder beim Durchgange der Ventilstange durch die Stopfbüchse
stattfindet, ohne daß dabei der richtige Verschluß des Ventiles beeinträchtigt wird.
Der Conus des Ventiles ist vollkommen in den Sitz eingepaßt und das Ventil selbst
ist mit einem Scheibchen von Wachsseidenzeug an seinem äußeren Rande so versehen,
daß jenes die flache Oberfläche des Ventillagers bedeckt. Die Ventilstange geht mit
ihrem oberen Ende so durch eine Oeffnung der Schlußplatte des Stiefels, daß die
Klappe genau vertical geöffnet wird.
Der Kolben ist von starkem Messing und aus zwei Theilen zusammengesetzt; die Bohrung
im oberen Theile ist etwas stärker als die Kolbenstange; jene des unteren Theiles
ist conisch so ausgearbeitet, daß ein massiver — leicht lüftbarer —
Kegel am unteren Ende der Kolbenstange hineinpaßt; dieser Kegel bildet das
Kolbenventil. Der untere Theil des Kolbens schließt sich zwar genau an die
Kolbenstange an, jedoch hat letztere genug Spielraum, um das Ventil zu öffnen; die
an dem unteren Theile des Kolbens an der betreffenden Stelle angebrachten kleinen
Oeffnungen gestatten der Luft freien Durchgang durch das Ventil beim Abwärtsgehen
des Kolbens. In dieser Phase wird nämlich das in der conischen Oeffnung sitzende
Ventil beim Oeffnen desselben in die cylindrische Oeffnung des oberen Kolbenstückes
ein wenig hineingedrückt, ohne die Bewegung des Kolbens mit Kolbenstange zu hindern.
— An der oberen Platte des Stiefels befindet sich ein drittes Ventil, welches
aus Wachstaffet in gewöhnlicher Weise angeordnet ist und der Luft den freien
Austritt gestattet, wenn der Kolben nach aufwärts geführt wird.
In die obere Platte des Stiefels ist ein stählerner Hebel eingelassen, von welchem
der eine Arm mit der Ventilstange verbunden ist, während der andere Arm beim
Aufwärtsgehen der letzteren gegen den inneren Raum des Stiefels, beim Schließen des
unteren Ventiles aber in die Höhlung der Oberplatte sich einlegen Kann.
Die Thätigkeit der Luftpumpe beim Hin- und Herziehen des Kolbens ist daher
leicht zu erkennen. Geht nämlich letzterer nach aufwärts, so schließt sich das
Kolbenventil, während das untere Ventil geöffnet wird, und die Luft kann nun vom
Recipienten in den Stiefel gelangen; gleichzeitig entweicht die auf der oberen Seite
des Kolbens im Stiefel befindliche Luft durch das obere Ventil. Wird der Kolben
wieder nach abwärts geführt, so wird das Kolbenventil gehoben, das untere aber
sogleich geschlossen, und die unterhalb des Kolbens befindliche Luft kann nunmehr
nach dem oberen Theile des Stiefelraumes sich verbreiten, ohne daß sie hierbei auch
zum kleinsten Theile in den Recipienten wieder zurückkehren kann. „Hat der
Kolben wieder den Boden des Stiefels erreicht, so ist die Verdünnung der an
diesen Stellen noch befindlichen Luft schon so groß, wie man sie überhaupt mit
den gewöhnlichen Ventil-Luftpumpen zu erreichen im Stande ist. Durch
fortgesetzte Thätigkeit des Kolbenspieles aber kann man im Recipienten eine
Verdünnung erhalten, welche fast dem Toricelli'schen
Vacuum nahe kommt; die Barometerprobe zeigt hierbei fast 1/50 eines engl.
Zolles. Die Versuche mit dem elektrischen Lichte gelingen dabei in glänzender
Weise; Wasser kann ohne Anwendung von Schwefelsäure (oder anderer
hygroskopischer Substanzen) zum Gefrieren gebracht werden u. s.
w.“
Tafeln