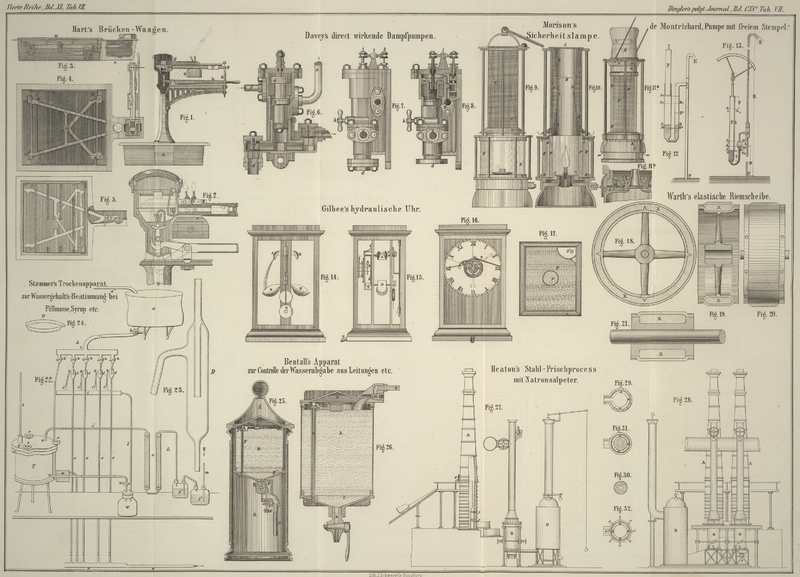| Titel: | E. H.Bentall's Apparat zur Controlle und Beschränkung der Wasserabgabe aus Wasserleitungen. |
| Fundstelle: | Band 190, Jahrgang 1868, Nr. CXIV., S. 440 |
| Download: | XML |
CXIV.
E. H.Bentall's Apparat zur Controlle und Beschränkung der Wasserabgabe aus
Wasserleitungen.
Aus dem Mechanics' Magazine, September 1868, S.
208.
Mit Abbildungen auf Tab.
VII.
Bentall's Apparat zur Controlle der Wasserabgabe.
Bei öffentlichen Wasserleitungen mit Abgabe auf den Straßen und in den Privathäusern
haben die Unternehmer darauf zu sehen, daß die möglicherweise per Tag entnommene Wasserquantität ein gewisses normirtes Quantum nicht
übersteige, um einestheils der Wasserverschwendung seitens der Consumenten
vorzubeugen, andererseits zu verhüten, daß bei böswilligem oder nachlässigem
längerem Offenstehen der Hähne der Verlust gewisse Grenzen überschreite. Zu diesem
Zwecke wurden schon verschiedene Apparate in Anwendung gebracht, in letzterer Zeit
auch derjenige von E. H. Bentall in Heybridge
(Essex).
Fig. 25 stellt
einen solchen in Anwendung auf Straßenbrunnen dar.
In dem Inneren der hohlen Säule A hängt das cylindrische
emaillirte Blechgefäß B an seiner oberen Flansche B2 und ist mit dem
Deckel B3 luftdicht
verschlossen. Der Hut A1 dient zum ornamentalen Abschlüsse der Säule. Der untere Theil des
Blechcylinders ist durch den conischen gußeisernen Boden B′ gleichfalls
luftdicht verschlossen. In der Mitte, als der tiefsten Stelle dieses Bodens, findet
der Zu- und Ablauf des Wassers statt, und zwar durch den angegossenen Ansatz
B4, in dessen
Innerem sowohl der Zulaufcanal a als der Ablaufcanal b angebracht ist. Auf diesen Oeffnungen bewegt sich der
Vertheilungsschieber c innerhalb des an dem Theile B4 dicht
angeschraubten Schieberkastens C, in welchen letzteren
das Abzweigrohr D der Wasserleitung mündet. Der
einarmige Hebel E, welcher seinen Drehpunkt in einem an
dem Schieberkasten oder der Säule angeschraubten festen Arm hat und außen vor der
Säule einen Griff trägt, dient zur Bewegung des durch eine Stopfbüchse geführten
Schieberstängchens c′. Das Eigengewicht des Hebels hat das Bestreben, den Schieber
abwärts zu ziehen und so das Gefäß B durch den Canal a mit dem Zuleitungsrohr D
in Verbindung zu setzen. Hebt man den Hebel hoch, so bedeckt der Schieber die beiden
Oeffnungen a und b, der
Abfluß des Gefäßinhaltes nach außen findet statt und dauert so lange bis der Hebel
niedergelassen wird oder bis der Behälter leer gelaufen ist. Das Gefäß ist überall
luftdicht verschlossen; es würde sich also nur bis zu einer gewissen Höhe anfüllen,
wenn es nicht mit der Röhre F versehen wäre, deren
unteres Ende durch den Boden B1 geführt ist und so das Innere des Gefäßes mit der äußeren Luft
in Verbindung setzt. An dem oberen Ende der Röhre ist ein Muff f mit Ventilsitz und Auge für den Hebel G aufgeschraubt. Bei dem Anfüllen des Behälters hebt der
Schwimmer g′ den Hebel und schließt das
Ventilchen g; die Luft kann nicht mehr entweichen, sie
wird comprimirt bis der Gleichgewichtszustand hergestellt ist, dann hört der
Wasserzufluß auf.
In Figur 26
ist ein Reservoir für ein Privathaus im Durchschnitt
abgebildet. Der Cylinder A besteht aus verzinktem oder
emaillirtem Eisenblech; er trägt an seinem oberen Theile einen angenieteten
gußeisernen Ring mit Flansche und ist durch seinen aufgeschraubten gußeisernen
Deckel B und Boden C dicht
verschlossen. An dem Deckel B findet der Einlauf, an der
tiefsten Stelle des Bodens der Auslauf durch den eingeschraubten Hahn D statt. E ist das mit dem
Deckel verbundene Zuleitungsrohr. Unter der Einmündung desselben ist eine durch die
Schraube F verschlossene Oeffnung angebracht. Der Canal
ist von dem Speiserohr E abwärts geführt und mündet in
der Verlängerung des Loches F in den Deckel. Diese
Einmündung ist mit einem Rothgußstopfen G verschraubt,
der einen genau berechneten gebohrten Durchlaß hat, damit unter dem gegebenen
ziemlich constanten Druck der Wasserleitung per Stunde
nur ein gewisses Wasserquantum durchfließen kann. Gleich dem
Straßen-Reservoir ist auch dieses mit einer Luftröhre I nebst Schwimmer und Ventil versehen.
Durch die Oeffnung F kann die genau gebohrte
Durchlaß-Schraube G nachgesehen und nach Bedarf
durch eine weiter oder enger gebohrte ersetzt werden. Nach Versiegelung des Stopfens
F ist die Wasserleitungs-Gesellschaft
versichert, daß durch diesen Apparat kein größeres Quantum Wasser als das von ihr
regulirte entnommen werden kann.
Tafeln