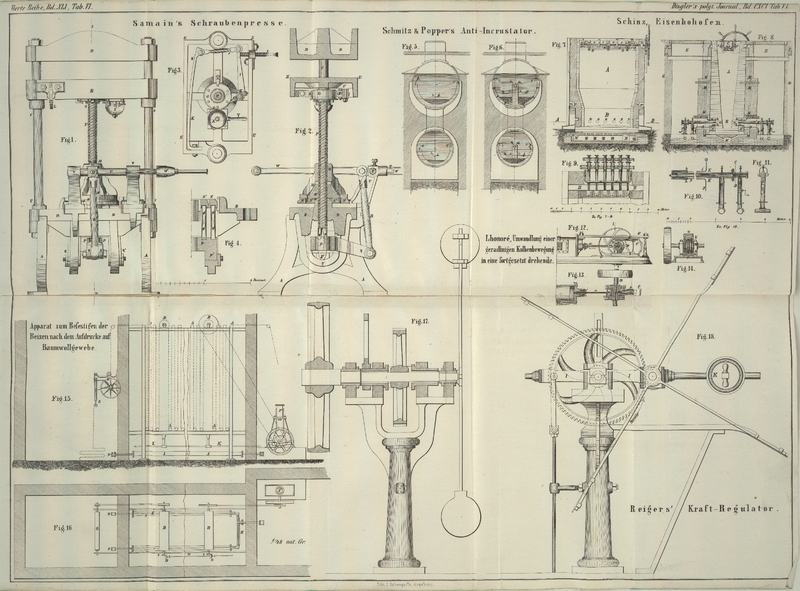| Titel: | Schinz's Eisenhohofen mit theilweiser Elimination des Stickstoffes der Gebläseluft durch Kohlenoxydgas. |
| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. LXII., S. 284 |
| Download: | XML |
LXII.
Schinz's Eisenhohofen
mit theilweiser Elimination des Stickstoffes der Gebläseluft durch
Kohlenoxydgas.
Mit Abbildungen auf Tab.
VI.
Schinz's Eisenhohofen mit theilweiser Elimination des Stickstoffes
der Gebläseluft.
Erfahrungsmäßig sind freier Wasserstoff und Kohlenoxydgas als Reductionsmittel für
Eisenerze ungleich wirksamer, als wenn sie durch den Stickstoffgehalt der
Gebläseluft (die in der Vergasungszone producirten Gase enthalten, abgesehen von
Wasserdampf und Kohlensäure, neben Kohlenoxyd an 65 Proc. Stickstoff) verdünnt
werden. Diesen Uebelstand sucht Schinz dadurch zu
vermeiden, daß mit der erhitzten Gebläseluft gleichzeitig heißes Kohlenoxydgas in
den Ofen geblasen, dadurch der Stickstoff theilweise eliminirt und, ohne der
Qualität des Productes zu schaden, in der Zeiteinheit eine größere Production
ermöglicht wird, da bei der Reichheit der reducirenden Gase die Reduction rascher
und vollständiger vor sich geht und die Anwendung reicherer Gichten zulässig
ist.
Eine Hohofenanlage nach diesem Princip erfordert „nach Schinz's Documente, betreffend den
Hohofen“ – besprochen im polytechn. Journal Bd. CLXXXIX S. 513
– nachstehende hauptsächliche Vorrichtungen.
1) Apparat zur Darstellung von erhitztem Kohlenoxydgas.
Dieser gleicht einem schlesischen Muffelofen zur Zinkgewinnung. Zwischen je zwei mit
Kohlenklein gefüllten Muffeln befindet sich eine solche mit Kalkstein, bei dessen
Erhitzen durch zugeleitete Gichtgase die ausgetriebene Kohlensäure durch kurze
Röhrenstücke in die glühenden Kohlenkleinmuffeln tritt, hier zu Kohlenoxyd reducirt
wird, dieses durch einen durchlöcherten Doppelboden über dem Hauptboden der Muffel
austritt und in eine Waschflasche gelangt. Vier
Muffelöfen haben je 18 Muffeln, deren jede 0,135 Kubikmeter Kalkstein oder
Kohlenklein aufnehmen kann. Das Gas gelangt in ein großes Reservoir, wird von hier durch drei Fouriet'sche Gebläsemaschinen
Polytechn. Centralblatt, 1858, Nr. 1. aspirirt und in die von Gichtgasen erhitzten Vorwärmapparate und von da in den Ofen geblasen. Fünf Fouriet'sche Maschinen, durch eine Dampfmaschine
getrieben, blasen die Verbrennungsluft in Wärmapparate und dann in den Ofen.
2) Eisenhohofen von Raschette'scher Construction, Fig.
7–11. A Ofenschacht. B Gestell, in welches Kohlenoxyd und Wind durch concentrische Düsen in 12
Formen a eingeblasen wird. K
sind die Luft- und L die Gasdüsen, beide durch
Bügel auf den senkrechten Zuleitungsröhren K' und L' luftdicht befestigt. Zur Kühlung des Gestelles tritt
Wasser durch g in die eisernen Wasserkästen H, von hier in die Wasserformen h und fließt aus diesen durch i ab. Eine
besondere Einrichtung hat die über 3 Kubikmeter fassende Vorwärmzone C, in welcher Erz und Kohks eine nur wenig hohe Schicht
bilden.
Die Sohle des Raumes C bildet ein dreieckiger gußeiserner
Balken D, durch die Ofenwände hindurchragend und an
beiden Seilen offen, so daß die Luft durch die Spalten b, b in C gelangen kann. Deßgleichen haben die an Zahnstangen
mittelst eines Getriebes e über dem Dachbalken behufs
des Chargirens auf- und niederschiebbaren Platten Spalten d zum Eintritt von Gasen, welche von der durch D zugeführten Luft verbrannt werden. Die übrigen
Gichtgase gelangen durch f in einen Gasreiniger E und von da durch die in Stützmauern G eingelassenen Röhren F an
ihren Bestimmungsort. M Feuerzüge beim Anwärmen des
Ofens.
Auf dem Eisenwerk zu St. Stephan in SteiermarkKerl, metallurgische Hüttenkunde, 1864, Bd. III
S. 350. – Resch, in der berg- und
hüttenmännischen Zeitung, 1868 S. 188. führte die Einleitung von Gichtgasen gemeinschaftlich mit Gebläseluft durch
die Form eines Kupolofens bei gleicher Production zu einer weit kürzeren
Campagnedauer und zu einer Brennmaterialersparung von 50 Proc. Bei diesem Verfahren
wird aber der Stickstoff nicht wie bei dem Schinz'schen
eliminirt. (Berg- und hüttenmännische Zeitung, 1869, Nr. 3.)
Tafeln