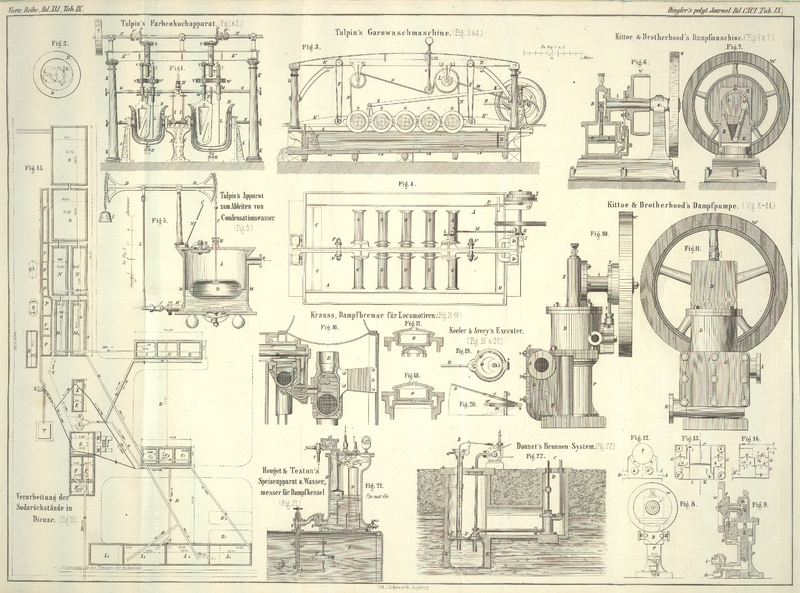| Titel: | Dampfmaschinen- und Dampfpumpen-System von Kittoe und Brotherhood in London. |
| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XCII., S. 440 |
| Download: | XML |
XCII.
Dampfmaschinen- und
Dampfpumpen-System von Kittoe und Brotherhood in London.Die Constructeure bezeichnen diese Systeme als
„Mustermaschinen“ (paragon
engines).
Nach dem Mechanics'
Magazine, December 1868, S. 501.
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Kittoe und Brotherhood's Dampfmaschine und Dampfpumpe.
I. Die Dampfmaschine (Paragon Steam engine).
Diese kleine, äußerst compendiöse Maschine von sechs Pferdekräften ist in Fig. 6 und 7 dargestellt;
sie dürfte dort Anwendung finden, wo des beschränkten Raumes wegen die Aufstellung
einer Dampfmaschine von größerer Nutzleistung nicht möglich ist und wo auch der
billige Anschaffungspreis dieser Maschine in's Gewicht fällt.
Mit dem Kolben K (Fig. 6) ist ein V förmig ausgeschnittener Gleitbacken B verbunden, in welchem die Kolbenstange S oscillirt und durch die Verbindung mit der Kurbelwarze
w an der Scheibe x der
Hauptwelle diese bei dem Auf- und Niedergang des Kolbens in drehende Bewegung
versetzt, welche durch die Riemenscheibe V übertragen
wird. Zur Ausgleichung der Unregelmäßigkeiten der Bewegung dient das Schwungrad W.
Die Theile S, w und x
arbeiten in dem mit dem Cylinder dicht verbundenen Gehäuse H, in welches seitlich durch die Stopfbüchse l, die Schwungradwelle eintritt.
Der Steuerungsschieber wird von der Scheibe y auf und ab
bewegt; es greift nämlich der an dem Ende der Schieberstange t sitzende Stift z in eine excentrisch
eingeschnittene Nuth der bezeichneten mit V in Einem
gegossenen Scheibe.
Um den Dampfraum oberhalb dem Kolben zu verringern, also Dampf zu sparen, ist der
erwähnte V förmig ausgeschnittene Backen B eingeschaltet, immerhin bleibt der schädliche Raum
bedeutend.
II. Die Dampfpumpe (Paragon Steam pump).
Eine ganz nützliche Verbindung der beschriebenen Dampfmaschine mit einer Pumpe ist in
den Figuren
8–14 dargestellt.
Fig. 8 und
9 zeigen
eine einfach wirkende Dampfpumpe; die Theile der Dampfmaschine sind wie oben
bezeichnet. Die weitere Anordnung ergibt sich deutlich aus den Figuren selbst.
Figur 10 und
11 zeigen
zwei Ansichten einer größeren doppelt wirkenden Dampfpumpe, deren Leistung je nach
der Größe pro Stunde 3000–10000 Gallons betragen
soll.
Der Pumpenkolben ist an die verlängerte Kolbenstange befestigt, welche dicht durch
die obere Pumpenplatte durchgeht. E bezeichnet das
Saugrohr, A das Druckrohr, G
ist der Ventilkasten; man kann nach dem Aufschrauben der sechs Schrauben s (Fig. 11) zu den Ventilen
gelangen, also leicht revidiren, resp. repariren.
Die Anordnung der Ventile und die Verbindung des Ventilkastells mit dem
Pumpencylinder dürfte die in den Skizzen Fig. 12, 13 und 14 dargestellte seyn.
Fig. 12 zeigt
im Grundriß den Pumpencylinder P und den Kasten G, dessen obere Wand weggedacht ist, so daß die
Druckventile d und d₁ sichtbar werden, während
die beiden Saugventile s und s₁ von der ersteren verdeckt sind.
In Figur 13
stehen zwei radiale Schnitte neben einander; I ist der Schnitt zu den linksseitigen,
II jener zu den rechtsseitigen Ventilen; denkt man sich die vordere Deckplatte des
Kastens G entfernt, so erscheint die Ansicht welche in
Fig. 14
skizzirt ist.
Der obere Schlitz a im Pumpencylinder steht mit a₁ ebenso b mit b₁ in Verbindung.
Geht somit der Pumpenkolben nach abwärts, so steigt das Wasser aus E durch das Ventil s nach,
während es unterhalb demselben durch
d' nach dem Druckrohre A und
von diesem an die gewünschte Stelle geleitet wird. Umgekehrt wenn der Kolben steigt,
so tritt das Wasser aus E durch das Ventil s₁ nach, geht aber durch a, a₁ und d zum Druckrohre A.
J. Z.
Tafeln