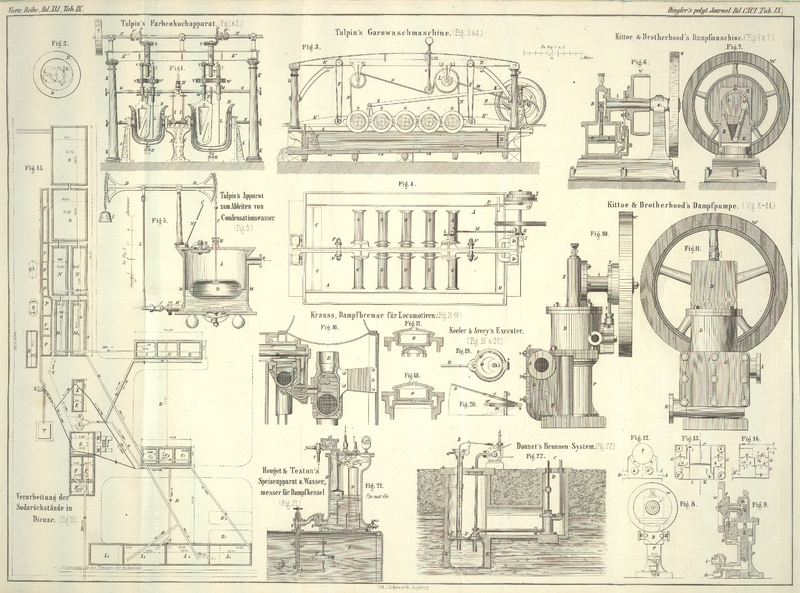| Titel: | Beschreibung der von Tulpin d. ält. in Rouen construirten Appretur-Maschinen. |
| Fundstelle: | Band 191, Jahrgang 1869, Nr. XCVCXV., S. 444 |
| Download: | XML |
XCVCXV.
Beschreibung der von Tulpin
d. ält. in Rouen construirten Appretur-Maschinen.
(Schluß von S. 362 des vorhergehenden
Heftes.)
Mit Abbildungen auf Tab.
IX.
Tulpin's Appretur-Maschinen.
III. Die Garnwaschmaschine.
In Färbereien und Wäschereien finden oft zur Ersparung von Handarbeit Maschinen zum
Waschen oder Spülen der Garne in geweiftem Zustande vortheilhafte Anwendung.Im polytechn. Journal Bd. CLXXIV S. 421 ist die Gantert'sche Garnwaschmaschine beschrieben, und in Bd. CLXXVI S.
113 die Raiser'sche (welche die Maschinenfabrik
von A. Wever und Comp.
in Barmen ausführt).
Tulpin's Garnwaschmaschine ahmt vortheilhaft die
Handarbeit nach, indem die Strähne hin und her gespült werden, während sie durch ein
Umziehen stets in eine andere Lage gelangen.
Zur Bedienung einer Maschine mit zehn Waschrollen sind zwei Arbeiter genügend; es
entspricht jede Waschrolle je 2 Handarbeitern, so daß also eine solche Maschine die
Arbeit von 20 Arbeitern, gewiß auch schneller und gleichmäßiger verrichtet.
Zur Bewegung wird 1/4 Pferdekraft als hinreichend angegeben.
Fig. 3 stellt
einen Verticalschnitt und Fig. 4 den GrundrißDieser wurde zu Fig. 3 nach einer
Zeichnung in Dr. Grothe's „Spinnerei, Weberei und Appretur
etc.“ skizzirt. dieser Maschine dar.
A bezeichnet einen hölzernen Kasten, in welchen aus dem
continuirlich gespeisten Vorraum B Wasser gelangen kann;
der Boden ist geneigt und das Schmutzwasser wird durch die verstellbare Schütze C oben und unten abgelassen, so daß alle Absonderungen
leicht weggeführt werden können. Ferner ist der Waschkasten A und der Wasserkasten B durch eine
Zwischenwand in zwei unabhängige Abtheilungen getheilt, so daß es hierdurch möglich
ist, verschieden gefärbte Garne zu gleicher Zeit zu waschen.
In diese Kufe taucht nun der eigentliche Waschapparat. An dem beweglichen Rahmen E' sitzen die Achsen der zehn Waschrollen G, deren Anordnung aus dem Grundriß ersichtlich ist und
welche gewöhnlich aus Kupfer verfertigt sind. Der Rahmen E' hängt an den im Querstück E eingezapften
Armen F, so daß dieser ganze Rahmen mit den Waschrollen
mittelst der Kurbel
J und der Schubstange K
in eine schwingende Bewegung versetzt wird.
Ferner geht über die Leitrollen L und L' und einen an jeder Waschrolle angebrachten Würtel die
Schnur N, welche durch die Spannrolle O angezogen werden kann; von der Hauptrolle H, an welcher auch ein Schwungrad sitzt, wird mittelst
Kegelrädchen und der geneigten Welle M, der Leitrolle
L und weiter sämmtlichen Waschrollen G eine drehende Bewegung ertheilt; letztere erhalten
somit mit den aufgehängten Garnsträhnen während dem Spülen eine hin und her gehende und gleichzeitig eine drehende Bewegung, so daß alle Garntheile eine gleiche Bearbeitung erfahren.
Mit wenigen Aenderungen kann diese Maschine auch zur vollkommenen Entfettung von
Wollsträhnen geeignet gemacht werden.
IV. Der
Farbenkoch-Apparat.
Dieser recht einfach und sehr zweckmäßig construirte Apparat ist in Fig. 1 theils im Schnitt,
theils in der Ansicht in 1/25 der wirklichen Größe dargestellt.
Vor Allem fallen darin die zwei verschieden großen Kessel B auf, deren Zahl jedoch nach Bedarf vergrößert werden kann; in den
Kesseln arbeiten je zwei Rührer L, L, welchen eine
doppelte Bewegung ertheilt wird: eine Bewegung der beiden Drehachsen in einer
Kreislinie – Pfeile 1 Fig. 2, und eine zweite,
die Drehung der Rührer um ihre Achse, also im Sinne der Pfeile 2 –, so daß
ein kräftiges Verrühren der kochenden Farbe sowohl als ein continuirliches
Abstreichen von den heißen Wänden erfolgt, um das Ansetzen der Farbe zu
verhindern.
Jeder Kessel sitzt an den in den Lagerstühlen A, A'
drehbar gelagerten Zapfen C und C'; ersterer ist massiv und hängt mit einer Sperrvorrichtung zusammen, um
den Kessel während dem Kochen festzustellen; der zweite Zapfen C' ist hohl und durch eine Stopfbüchse mit dem
Rohrstutzen I' verbunden; solcher zwei münden in einen
dreifach durchbohrten Hahn J, J, zu welchem die Röhren
I laufen, durch welche kaltes Wasser aus der
Rohrleitung G zugeführt wird, während die Rohrleitung
F' Dampf bis zu den Hähnen J,
J leitet. Je nach der Stellung des Hahnes wird also entweder frisches,
kaltes Wasser oder Dampf unmittelbar in den, den Kochkessel umgebenden Raum
zugelassen, oder deren Zuleitung abgeschlossen.
Wie aus dem Schnitt durch den Kessel B zu ersehen ist,
besteht derselbe eigentlich aus drei Gefäßen: dem innersten aus Kupfer getriebenen,
dem eigentlichen Kochkessel; diesen umgibt auf eine mäßige Entfernung der erste Mantel, dampfdicht
abgeschlossen; in den zwischen beiden bleibenden Raum gelangt das Wasser oder der
Dampf. Die Zuleitung des kalten Wassers erfolgt nicht allein aus dem Grunde, um den
Kochkessel für die Ausleerung und weitere Benutzung rasch abzukühlen, sondern mehr
in der Absicht, um damit dem Anhängen der Farbe bei einer langsamen Abkühlung zu
entgehen. Der Hahn E wird dann zur Ableitung des Wassers
geöffnet; ebenso findet eine zeitweilige Oeffnung desselben zur Abführung von
Condensationswasser statt, welches bei der Zuführung von Dampf zum Kochen der
Farbflüssigkeit entsteht.
Um nun die Verluste der strahlenden Wärme aus dem Heizmantel möglichst zu mindern,
gibt Tulpin noch einen Mantel um den Kochkessel und füllt
den Zwischenraum mit Kohlenpulver aus.
Der Hebel D erleichtert das Umkippen des Kochapparates
B nach beendetem Kochen. Um dieses jedoch möglich zu
machen, müssen die Rührer L hinreichend gehoben werden
können; aus diesem Grunde ist die Achse, an deren unterem Ende der Rührer sitzt, aus
zwei, in der gewöhnlichen Stellung von einander abstehenden Theilen geschmiedet,
deren Enden der Muff M einschließt, wodurch eine gewisse
Hebung von L gestattet ist.
Die Bewegung eines jeden Rührerpaares erfolgt – wie das Kochen, die
Wasserzuleitung etc. – unabhängig von einander und zwar von der, durch einen
auf der Scheibe O auflaufenden Riemen bewegten
Transmissionswelle N, deren Lager auf einer durch Säulen
K, K unterstützten Traverse K' aufruhen, P, P' deuten Kuppelungen an,
welche der Arbeiter mit einem Hebel nahe dem Kessel dirigiren kann, um die Drehung
der lose auf der Welle sitzenden Kegelräder P und
hierdurch jene der Rührer einzuleiten oder abzustellen.
An der Achse des mit P in Eingriff stehenden Rades Q ist unten der zweilappige Theil T befestigt, dessen von Q aus bewirkte Drehung
die in Figur 2
mit dem Pfeile 1 bezeichnete Bewegung der Rührer hervorbringt. An der unbeweglichen
Hülse R sitzt das Getriebe S, welches in jenes U eingreift, das an der Achse
eines Rührers sitzt. Bei der Drehung von T wickelt sich
U an S ab, dreht die
Achse des Rührers im Sinne des Pfeiles 2; das Räderpaar V und W überträgt diese Drehung auch auf den
zweiten Rührer.
Aus dem Anblick der Figuren ergibt sich, daß die arbeitenden Rührer um 90°
gegen einander verstellt sind.
V. Apparat zur Ableitung von
Condensationswasser.
Der mit dieser Vorrichtung zu erreichende Zweck besteht darin, den Abfluß des Condensationswassers
ohne Dampfverlust aus Apparaten zu besorgen, in
welchen Dampf zum Kochen, zum Heizen, zum Trocknen etc. benutzt wird; gleichzeitig
ist man bei Anwendung des in Fig. 5 in 1/10 der
wirklichen Größe dargestellten Apparates aller Unannehmlichkeiten enthoben, welche
mit den gewöhnlichen Anordnungen verknüpft sind, wie die Bewachung der
Wasserablaßhähne, die Beaufsichtigung sorgloser Arbeiter etc.
Uns sind Fälle bekannt, daß man, um ein Beispiel herauszugreifen, beim Heizen der
Trockencylinder einer Papiermaschine auf den Abfluß des Condensationswassers
(unglaublicher Weise) gar nicht achtete, wobei natürlich sehr viel Dampf mit
entwich; welchen Einfluß dieser auf den Kostenpreis der Trocknung nahm, zeigte die
Erfahrung nach einer zweckmäßigen Abstellung dieses Uebelstandes, wodurch der
Kostenpreis um mehr als die Hälfte vermindert wurde.
Der von Tulpin construirte Apparat besteht im Wesentlichen
aus dem cylindrischen Gehäuse A, welches durch das Rohr
H mit dem mit Dampf geheizten Raum in Verbindung
steht, aus welchem das Condensationswasser abzuleiten ist. Dieses erreicht im
Cylinder A die normale Höhe M,
M, bei welchem Wasserstand der Schwimmer B und
der von diesem beeinflußte Balancier D eine solche
Stellung einnehmen, daß der von der Zugstange verstellbare Hahn J am Wasserleitungsrohr H'
verschlossen bleibt. Je mehr das Wasser in Folge des Zuflusses durch H steigt, desto mehr öffnet sich der genannte Hahn, ohne
jedoch einen vollständigen Abfluß des Wassers und erst hierauf mögliche
Dampfabströmmung zu gestatten.
Die hakenförmig endende Stange N hat den Zweck, den
Balancier zu unterstützen und dadurch den Schwimmer in einer etwas erhöhten Lage,
und zwar einige Minuten vor Beginn der Ingangsetzung des Apparates zu erhalten.
Der Deckel F verschließt hermetisch die am Boden
angebrachte Oeffnung, durch welche der Schwimmer in's Innere des Cylinders
eingeführt wird.
Tafeln