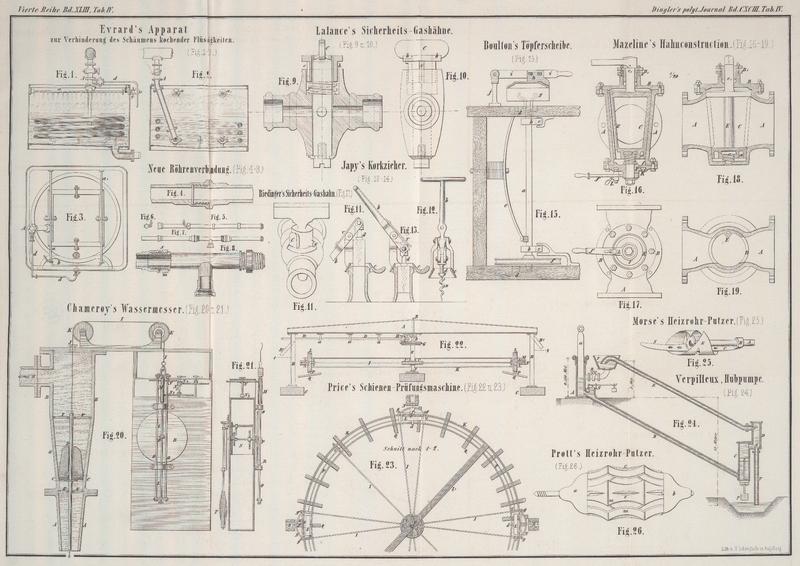| Titel: | Chameroy's Wassermesser. |
| Fundstelle: | Band 193, Jahrgang 1869, Nr. XLIII., S. 185 |
| Download: | XML |
XLIII.
Chameroy's
Wassermesser.
Nach Engineering,
Februar 1869, S. 135.
Mit Abbildungen auf Tab.
IV.
Chameroy's Wassermesser.
In Fig. 20 und
21 ist
ein neuer Wassermesser dargestellt, welcher kürzlich für E. A. Chameroy in Paris patentirt wurde. Die Wirkung desselben gründet sich auf
die Möglichkeit der Abschätzung eines Flüssigkeitsvolumes, welches unter constantem
Druck durch eine Oeffnung von variablem Querschnitte durchfließt. Die Veränderung
des letzteren übt einen entsprechenden Einfluß auf die variable Bewegung des
Zählwerkes, welche von der constanten Schwingung eines Pendels oder von einem
anderen Bewegungsmittel ausgeht.
Die Art, in welcher die Veränderung der Durchflußöffnung bei Chameroy's Wassermesser registrirt wird, geht deutlicher aus den
bezeichneten Figuren hervor; Fig. 20 ist ein
Verticalschnitt, von vorn betrachtet, und Fig. 21 ein Querschnitt
mit der Ansicht des Trieb- und Zählwerkes.
A bezeichnet die Flüssigkeitszuflußröhre; B ist das Gehäuse des Meßapparates; C ist ein Ventil, welches auf einer schmalen
vorspringenden Sitzfläche des Gehäuses ruht; D ist eine
durch die Leitstücke F und E
durchgehende Spindel zur Führung des Ventiles. Dieses bewegt sich im conischen Theil
G des Gehäuses, so daß die Durchflußöffnung größer
oder kleiner wird, somit mehr oder weniger Flüssigkeit bei H abfließen kann.
Die Bewegung des Ventiles wird durch den Draht oder die Schnur I über die Leitrollen K nach dem
Registrirmechanismus übertragen.
An dem rechten Ende dieses Drahtes I hängen als
Gegengewicht das Stangenpaar O, O mit der drehbar
gelagerten Spindel L, an derem oberen Ende das Getriebe
M sich befindet, welches die Drehungen dieser
Spindel mit Hülfe der Zahnräder N bis N₄ auf den Zählapparat überträgt.
Die Drehung erhält die Spindel von einem Uhrwerke. S ist
das Federhaus, dessen Bewegung das Pendel T regulirt und
die gleichmäßige Uebertragung auf die Frictionsscheibe
R vermittelt. Von hier aus geht die Bewegung auf die
Frictionsrolle P, welche fest auf der Spindel L sitzt. Diese wird sich somit um so rascher drehen, je größer der Abstand der
Rolle P von dem Mittelpunkt der Frictionsscheibe R ist, welche Distanz aber nur von der Stellung des
Ventiles C, somit von der Größe der veränderlichen Durchflußöffnung im
Gehäuse G abhängt.
Die Wirkung dieses Apparates, wie er gerade für Haushaltungszwecke angeordnet wurde,
ist somit folgende: das Zuleitungsrohr A steht in
Verbindung mit der Wasserleitung; alles die Röhre H
passirende, also ausfließende Wasser gelangt vorher zur Wirkung auf das Ventil C, respective auf das Zählwerk.
So lange kein Wasser durch das Ventil G hindurch fließt, so lange behauptet es seine Stellung
derart, daß die vorgenannte Frictionsrolle P an der
Spindel L im Mittelpunkt der Scheibe R steht, somit keine Bewegung auf das Zählwerk
übertragen wird.
Wenn aber der Abfluß der Flüssigkeit durch Oeffnen eines Hahnes am Abflußrohr H gestattet wird, so vermindert sich dadurch der Druck
auf die obere Seite des Ventiles C; das unterhalb
befindliche Wasser hebt es so weit, daß gerade so viel Wasser bei A zutreten kann als bei H
abfließt. In dieser Stellung bleibt das Ventil stationär, indem der Ueberschuß des
Druckes des aufsteigenden Wassers über den Druck der auf dem Ventil lastenden
Wassersäule mit dem Uebergewicht des Ventiles (mit Rücksicht auf das Gegengewicht
O, O) das Gleichgewicht halten wird.
Jeder bestimmten Lage des Ventiles entspricht mithin ein bestimmter Wasserabfluß;
einer und derselben Lage entspricht stets eine voraus zu bestimmende oder durch
Versuche festgestellte Angabe des Zählwerkes, da die Rolle P im bestimmten Abstand vom Mittelpunkt der Scheibe R aufliegt. Vermindert sich die Menge des abfließenden Wassers, so wird
das Ventil sinken und demzufolge eine geringere Bewegung auf das Zählwerk
übertragen, bis endlich diese Null wird, wenn das Ventil auf seinen Sitz sich
auflegt, also der Durchfluß vollkommen unterbrochen ist.
Es unterliegt somit keiner Schwierigkeit, die Angabe des Meßapparates in genauen
Einklang mit der factischen Abflußmenge zu bringen. Derselbe kann für großen oder
geringen Druck zur Verwendung kommen, auch dort, wo plötzlich große
Druckveränderungen eintreten.
Jedenfalls ist der Apparat sinnreich construirt; seine praktische Verwendbarkeit muß
aber eine größere Reihe genauer Versuche erproben.
Bedenken erweckt die Verbindung des Ventiles mit dem Zählwerk durch die Schnur oder
den Draht I. Wird die leichte Beweglichkeit desselben in
der Stopfbüchse J auch vorhanden seyn, wenn der Apparat
längere Zeit außer Thätigkeit war?
J.
Z.
Tafeln